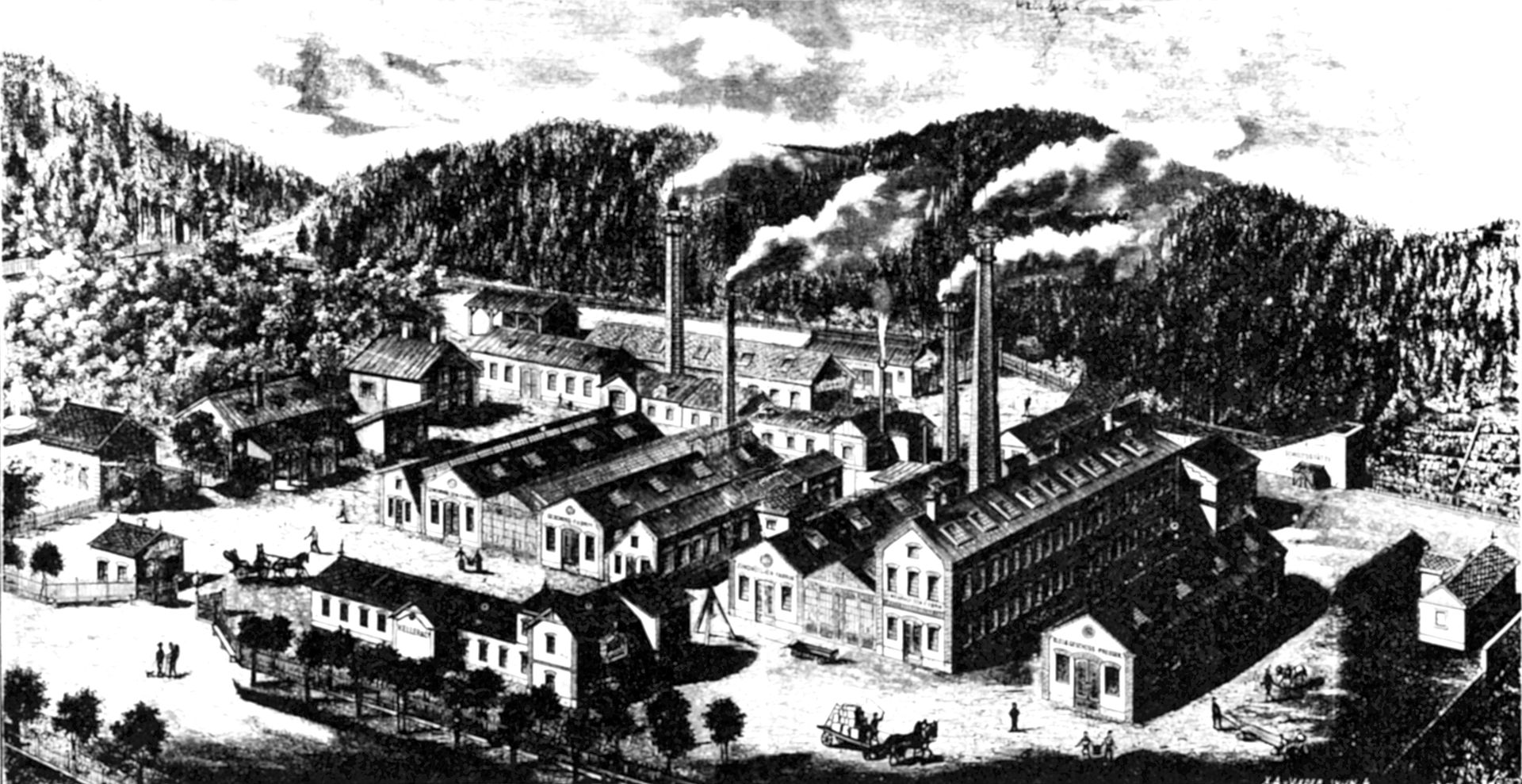Als Frau alleine reisen? Bis heute scheidet diese Frage die Geister. Vor allem wenn es um Regionen geht, die für Frauen* als problematisch gelten. progress hat mit drei jungen Frauen geredet, die alleine unterwegs waren – und es nicht bereut haben.
Meryl, Stephi und Tessa haben zwei Dinge gemeinsam: Sie haben den Wunsch gefasst, alleine wegzufahren, und sie haben sich nicht durch Vorurteile davon abhalten lassen. „Der Grund für meine erste Soloreise war damals nicht mehr als ein vages Gefühl. Ich habe gespürt, dass ich mal Zeit für mich brauche – und zwar wirklich“, erzählt Tessa, die nun schon mehrmals alleine in Norwegen war. Die Frage, ob sie anfangs unsicher war, bejaht sie: „Davor habe ich nur Nachteile gesehen: niemand, den ich kenne, niemand, mit dem ich reden kann, niemand, der mir helfen kann.“ Aber schließlich war alleine unterwegs zu sein für Tessa befreiend und ungezwungen. „Du bist sowieso nie ganz alleine“, erklärt Meryl, die nach Südostasien und Indien gefahren ist. „Du triffst vor Ort Gruppen oder lernst einzelne Leute kennen, mit denen du etwas unternimmst. Das geht viel besser, wenn du solo unterwegs bist. Du kannst dich richtig in das Land fallen lassen.“ Meryl fuhr weg, weil sie eine Auszeit brauchte: „Irgendwie ist es mir in Österreich einfach zu viel geworden. Ich hab mir gedacht – einfach weg. Und dann bin ich sechs Wochen nach Thailand gefahren.“ Nicht alle können einen solchen Entschluss sorglos hinnehmen. Als Stephi nach Indien und Australien reisen wollte, löste sie einen Familienstreit aus.
Reisevorbereitungen. Um als Frau alleine sicher zu sein, ist es nicht unbedingt notwendig, die ganze Reise bis ins kleinste Detail durchzuplanen – ganz im Gegenteil. Als Meryl sechs Wochen lang durch Südostasien reiste, hatte sie nur zwei Dinge geplant: Hinflug und Rückflug. Alles dazwischen überließ sie dem Zufall und war erfolgreich. Ähnlich hielt es Stephi. Tessa hingegen wusste im Vorhinein immer zumindest, zu welchem Zeitpunkt sie in welcher Stadt sein und wo sie unterkommen würde. Sie informierte sich davor aber kaum über die Städte: „Bei der Tagesplanung bin ich spontan. Ich will mich von der Stadt überraschen lassen und möglichst ohne vorgefertigtes Bild im Kopf hinfahren, damit ich einen eigenen Eindruck von der Stadt bekomme.“ Alle drei bekamen vor Ort oft Rat von anderen Tourist_innen oder Einheimischen – darunter auch „Geheimtipps“, die in keiner Reiseführerin erwähnt werden.
Spontan blieb Meryl auch auf ihrer zweiten Reise. Ursprünglich wollte sie nach Nordindien, doch dafür war sie zu kalt angezogen. „Ich dachte, ich könnte warmes Gewand am Weg kaufen, aber dazu war ich noch nicht weit genug im Norden.“ Schließlich ist sie umgekehrt und hat den Süden bereist, bis hin zu einer kleinen Inselgruppe vor der Küste Indiens, wo sie tauchen war. Auch wegen der günstigen Unterkünfte in Indien war es für Meryl nicht so wichtig vorauszuplanen wie für Tessa in Norwegen. Tessa wohnte dort oft in halbprivaten Unterkünften, um sich die Reise leisten zu können. Sie verließ sich bei der Wahl ihrer Unterkünfte auf ihr Bauchgefühl und fand über Airbnb und Couchsurfing Gastgeber_ innen. Durchs Couchsurfen können auch Reisen in teure Länder erschwinglich werden, hier bekommt frau auch alleine leichter eine Unterkunft. „Leute sind zu Frauen oft netter und hilfsbereiter“, meint Tessa, die sich im Vorfeld oft Gedanken über ihre Sicherheit gemacht hat.
Kennenlernen. Das wohl größte Abenteuer für alle drei war das Zusammentreffen mit anderen Menschen. „Ich bin relativ schüchtern“, meint Tessa, während sie von ihren Erlebnissen mit Fremden berichtet. Für sie war es ein Sprung ins kalte Wasser, der sich mehrfach bewährt hat. So lernte sie auf einer Zugfahrt jemanden kennen, der in einer Band spielt, und wurde von ihm zum Konzert und zu einer Backstageparty eingeladen. Zug- und Busfahrten so wie gemeinsame Ausflüge sind gute Möglichkeiten, andere nicht nur oberflächlich kennen zu lernen.
Auch Meryl berichtet von einer Fahrt im Zug, auf der sie sich für 24 Stunden mit zehn fremden Menschen ein Liegeabteil teilte. Überrascht hat sie, wie nah sie in solchen Situationen den anderen kam: „Obwohl wir alle aus unterschiedlichen Kontexten gekommen sind, haben wir alles gemeinsam gemacht – Essen geteilt und gemeinsam gegessen, auf ein Kind aufgepasst, miteinander geredet und einander trotzdem Freiraum gegeben. Nachdem ich aus dem Zug ausgestiegen bin, hab ich wieder niemanden gekannt. Eine schräge Erfahrung.“
Für Stephi war ihre Reise auch eine Möglichkeit, eine neue Sprache zu lernen: Hindi. „Im Vorfeld haben mir alle gesagt, dass in Indien alle Englisch reden. Ich hab’ dann aber eine Zeit lang mit Nepales_ innen zu tun gehabt, die in der Schule nur Hindi gelernt haben und kein Englisch.“ Meryl sprach zwar nicht Thai, dafür aber viel Englisch. „Irgendwann wollte ich nicht mehr auf Deutsch mit anderen reden. Ich habe sogar auf Englisch gedacht und auch mein Reisetagebuch auf Englisch geführt.“
In einer weiteren Hinsicht sind sich alle drei einig: Sie fielen als alleine reisende Frauen auf. Stephi meint, dass das in Australien am wenigsten der Fall gewesen sei, da sehr viele Frauen aller Altersgruppen alleine dorthin fahren. Einige Male fungierten Männer temporär als „Beschützer“, wenn sie zum Beispiel darauf bestanden, sie zum Markt zu begleiten, weil sie Angst um sie hatten. Für Stephi eine seltsame Erfahrung. Sie selbst wirkte auch als positives Vorbild: „Es war schön zu sehen, dass die indischen Mädchen, die total behütet aufwachsen – Mädchen aus reichen Familien werden behandelt wie Prinzessinnen –, das bei mir gesehen haben und dann gesagt haben, dass sie auch einmal alleine verreisen möchten.“
Keine Angst. Stephi fiel im Norden Indiens auf: „Ich war eindeutig Ausländerin, aufgrund meiner Sprache und meines Verhaltens. Aber wenn ich mich indisch gekleidet habe, bin ich gut untergetaucht.“ Manchmal fühlte sich Stephi in Indien sogar wohler als in Wien, wo sie schon öfter belästigt wurde. „Von Indien sagt man, dass Frauen dort nicht respektiert werden. Ich hatte dort aber eher das Gefühl, dass ich nicht angeschaut werde, wenn ich das nicht will“, meint Stephi. „Ich wurde nicht angegriffen. Die Männer waren viel vorsichtiger im Umgang mit mir, aber wahrscheinlich ist das auch lokal unterschiedlich.“ Gleichzeitig mit Stephis Indienreise waren Beiträge in Medien präsent, die von den Vergewaltigungen an Frauen und auch an Touristinnen in Indien berichteten. Viele davon wirkten für Frauen angstmachend. Dass der Situation in Indien so große mediale Auf merksamkeit zukam, findet sie aber auch positiv, weil dies auf eine Veränderung im Land zurückzuführen sei. Viele Freund_innen, die sie damals kennenlernte, gehen jetzt auf Demos für Frauenrechte und gegen die Tabuisierung von Sexualität.
Viele der Ängste, die Frauen betreffen, die alleine reisen, drehen sich um sexualisierte Gewalt, die durch Medienberichte über Vergewaltigungen vor allem mit asiatischen Ländern in Verbindung gebracht wird. Stephi machte, um Selbstbewusstsein zu tanken und um zu wissen, dass sie in schwierigen Situationen einen kühlen Kopf bewahren kann, vor ihrer Abreise einen Selbstverteidigungskurs. Zu lernen, sich bei Übergriffen zu wehren, kann gut tun. Um mit lokaler Diskriminierung umgehen zu können, empfiehlt Stephi auch sich auf die religiösen und kulturellen Eigenschaften eines Landes vorzubereiten, vor allem, was Traditionen der Bekleidung betrifft. „Ein Bikini ist in Indien weniger als normale Unterwäsche. Das muss dir vorher klar sein.“
Viele Gefahren, die Frauen auf Reisen betreffen, gelten genauso für Männer, weshalb sich Stephi darüber ärgert, dass vor allem Frauen Angst gemacht wird. Sie erzählt von dem einzigen Mal, als sie in Indien wirklich Angst hatte – und das war nicht die Schuld von Menschen. „Einmal bin ich um fünf in der Früh laufen gegangen und wohl durch das Revier von Affen gekommen, die mich angeschrien und mit Zapfen und Nüssen nach mir geworfen haben.“
Dass es Situationen gibt, die vor allem für Frauen unangenehm sind, können die drei allerdings nicht abstreiten. Auch Tessa machte in Norwegen unangenehme Erfahrungen mit einem Mann, der ein „Nein“ nicht akzeptieren wollte, als sie abends Biertrinken war. Die Situation ging glimpflich aus und stellt für Tessa eine Ausnahme dar, da sie beobachtete, dass Männer in Norwegen im Allgemeinen ein „Nein“ besser verstehen als in Österreich. Ein unangenehmes Gefühl bleibt für sie trotzdem, wenn sie an den Vorfall zurückdenkt. Auch Meryl mied bestimmte Situationen – beispielsweise nachts allein am Strand unterwegs zu sein. Das Wichtigste sei, sich darauf einzustellen und immer selbstbewusst aufzutreten, egal ob in Verhandlungen mit dem Taxifahrer oder alleine auf der Straße. Falls es dennoch zu einem Übergriff kommt, ist es wichtig, sich nicht selbst die Schuld daran zu geben. In allen Ländern, in denen Frauen als schwach gelten, gibt es solche Probleme – Belästigung, Übergriffe oder auch Vergewaltigung. Doch aus Angst zu Hause bleiben sollten Frauen auf keinen Fall, da sind sich Stephi, Meryl und Tessa einig.
Magdalena Hangel lebt in Wien, schreibt an ihrer Doktorinnenarbeit im Bereich der Germanistik.
www.women-on-the-road.com
wikitravel.org/
Stephis Reiseblog: www.mahangu.com/trip/AFD/waypoint-1