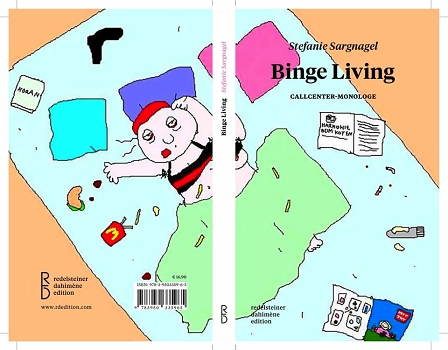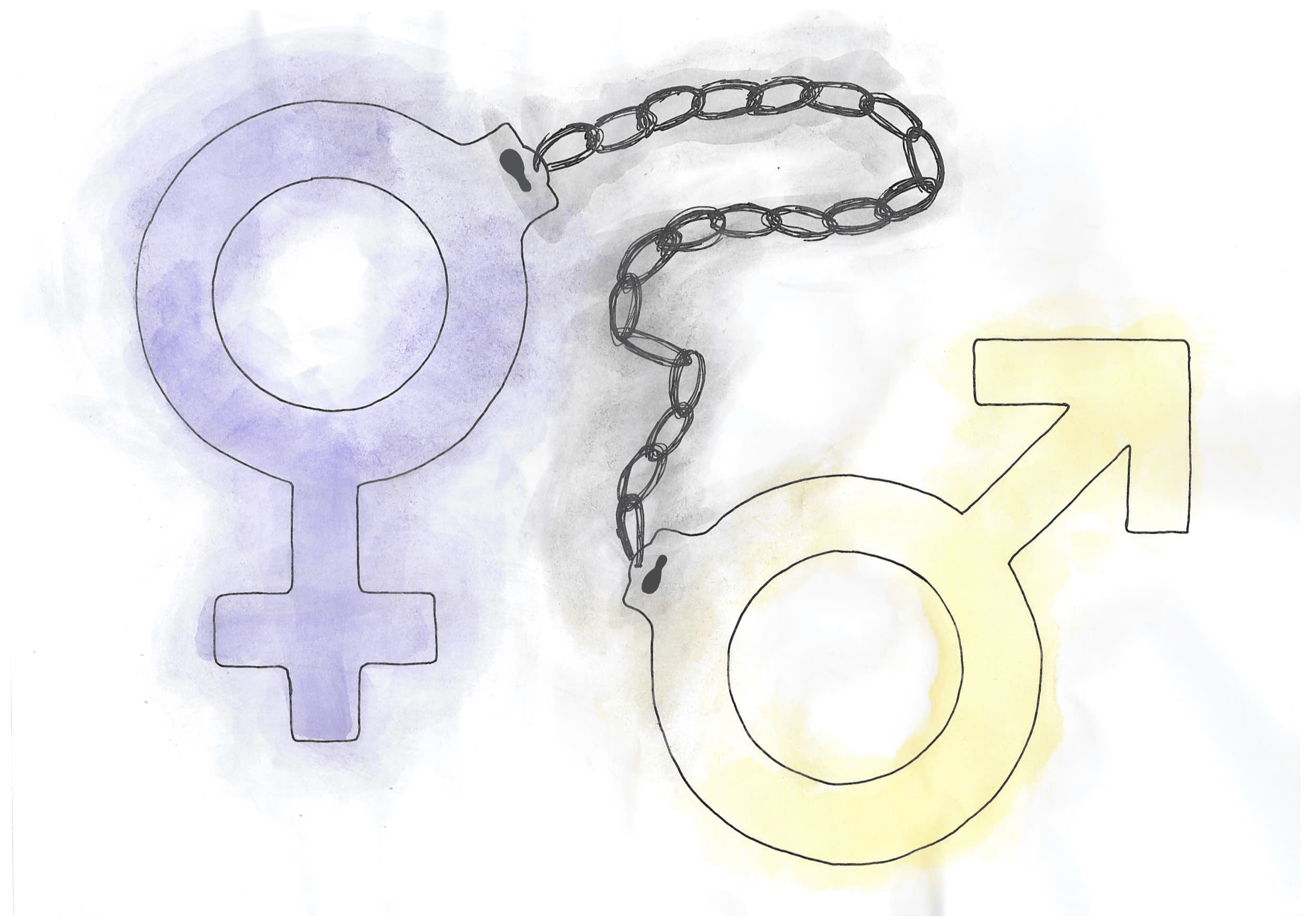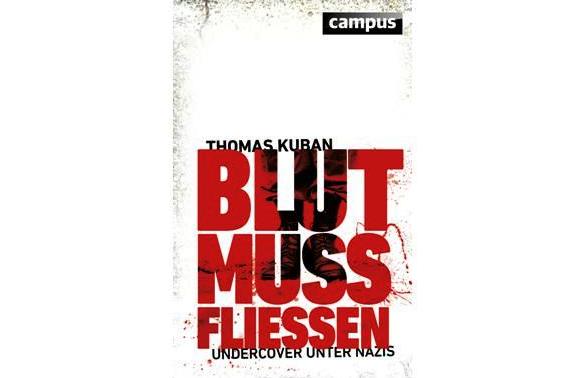„Ich bin nicht auf der Reise zu den Wurzeln“
Die israelische Zeichnerin Rutu Modan illustriert in ihrer Graphic Novel „Das Erbe“ Verwicklungen im Bermudadreieck Familie-Geld-Liebe
Die israelische Zeichnerin Rutu Modan illustriert in ihrer Graphic Novel „Das Erbe“ Verwicklungen im Bermudadreieck Familie-Geld-Liebe
Mica Segal, ehemalige Krav-Maga-Trainerin in der israelischen Armee und aktuell Radio-Redakteurin, reist mit ihrer Großmutter Regina nach Warschau, um im Zweiten Weltkrieg verloren gegangen Familienbesitz zu finden. Im Schlepptau: Ein unsympathischer, aufdringlicher und übergriffiger Bekannter der Familie, der die Vorhaben der beiden Frauen immer wieder stört, unterbricht oder unterwandert.
Dies wird ihm zugegebenermaßen durch die Launigkeit und die ständigen Gemütswechsel der Großmutter sehr einfach gemacht: Kaum angekommen, erklärt sie ihre eigene Mission als beendet, lässt ihre Enkelin in der Stadt stehen und gibt vor, sich lieber dem Shopping und Sightseeing widmen zu wollen: Oma als „enfant terrible“.
Der klare, subtile Stil der Autorin Rutu Modan ermöglicht es der Leserin, den zahlreichen Fäden und Linien zwischen den Themen zu folgen. Familienthriller? Liebesgeschichte? Medienkritik? Holocaustliteratur? All das, nichts davon und gleichzeitig viel mehr. Sie macht auch nicht vor unbequemen Vorurteilen oder Antisemitismen halt. Über die üblichen Identitätsfragen zeigt sich Modan erfrischend erhaben: „Ich bin nicht auf der Reise zu den Wurzeln“, erklärt Mica Segal bestimmt auf die Spöttelei, was eine junge jüdische Frau denn bitte nach Warschau treibe.
Geschichte, gestohlen. Interessant bei Modans Graphic Novel ist die Entscheidung des deutschen Verlages, sich bei der Übersetzung des Titels für das Wort „Erbe“ zu entscheiden. Im Englischen heißt das Buch „The Property“, was eins auch mit „der Besitz“ oder „das Besitztum“ übersetzen könnte. Dieser Begriff erscheint oft als der bessere Titel, da es sich in der Geschichte nicht ausschließlich um einen klassischen Erbschaftsstreit handelt.
So spielt Modan in ihrem Comic selbstrefenziell mit der Frage, wessen Eigentum eigentlich (Familien-)Geschichten und Biografien sind, indem sie ihre Protagonistin auf einen polnischer Comic-Zeichner treffen lässt, der sich von Micas Familiengeschichte prompt zu einem Kunstwerk inspirieren lässt. „Blutsauger!“, quittiert Mica seinen Diebstahl, jagt den jungen Mann fort, behält und versteckt seine Zeichnungen. „Hau ab, oder ich ruf die Rezeption an. Ich sag’ ihnen, ein junger Antisemit greift mich an.“
Wie und ob eins (insbesondere Holocaust-)Geschichte thematisieren kann, fragt Modan auch in scheinbaren Randnotizen zu Museen, akkuraten architektonischen Nachbauten, Führungen für Schulklassen und historischen Nachstellungen („Reenactments“, wortwörtlich übersetzt sogar „Wiederbetätigungen“). So wird Mica Segal in der Graphic Novel sogar versehentlich von „Nazis“ verschleppt.
Grafiken zum Hören und Fühlen. Erstaunlich sympathisch ist die Darstellung von Gemurmel oder für die Protagonistin Unverständlichem: Modan kritzelt einfach Wellenlinien in die Sprechblasen. Die Bedeutung erschließt sich für die Leserin aus dem Bild, dem Kontext, die genauen Worte sind irrelevant und daher durch Geschmiere gut repräsentiert. So schafft die Autorin mitunter, in der Graphic Novel eine unkonventionelle bildliche Entsprechung von akustischen Phänomenen wie Geflüster zu malen.
Dies ist nicht die einzige Wechselwirkung zwischen Film und Bild bzw. Comic: Mit dem Arrangement der Panels und Bilder schafft Modan Erstaunliches. Der Lärm und die Unruhe der Schulklasse im Flugzeug in einer der Anfangsszenen sind beim Lesen beispielsweise regelrecht zu hören und zu spüren. Eine sinnreiche Graphic Novel – in jeder Hinsicht.
Olja Alvir studiert Germanistik und Physik an der Universität Wien.

Rutu Modan, Das Erbe. Carlsen Verlag, 240 Seiten, 14,90 Euro.