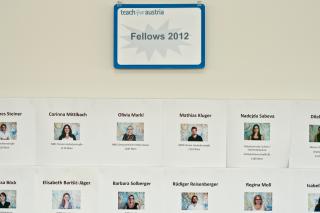Die kommenden Herausforderungen der ÖH
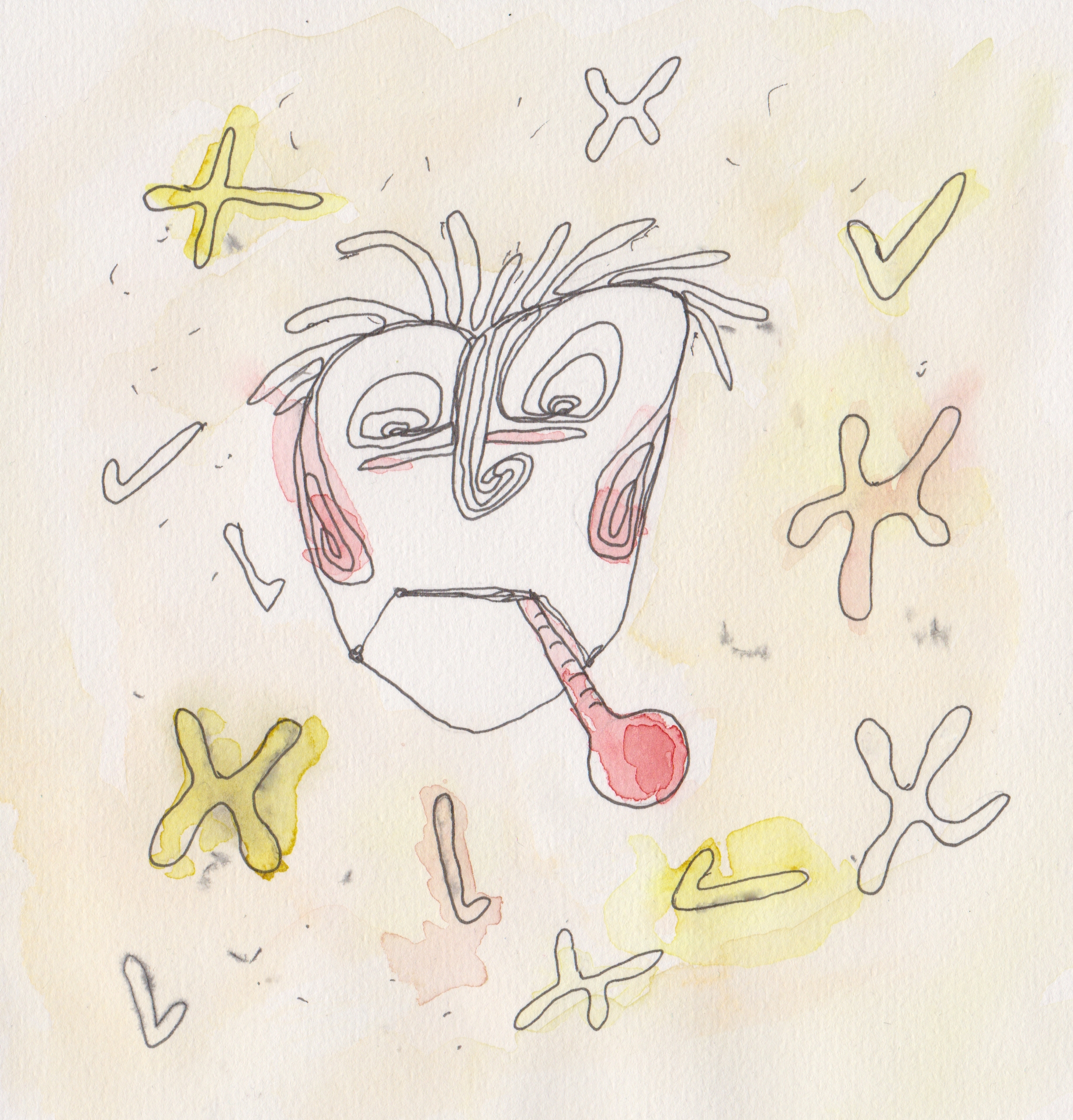
Alle zwei Jahre wählen Österreichs Studierende ihre Vertretung, seit 2015 wird auch die Bundesvertretung wieder direkt gewählt. Welche Probleme und Herausforderungen werden sich der künftigen ÖH-Spitze stellen und wie wollen die Fraktionen damit umgehen?
In den letzten Jahren haben sich große Demonstrationen oder Aktionen zum Thema österreichische Bildungspolitik rar gemacht. Das heißt aber leider nicht, dass sich die Situation an den Hochschulen entspannt hätte – es haben nur alle gelernt, damit zu leben. Maßnahmen wie die Studieneingangs- und Orientierungsphase (StEOP), gegen deren Einführung 2009 noch heftig protestiert wurde, sind heute für Studienanfänger_innen Normalität geworden, die nicht unbedingt hinterfragt wird.
STUDIENPLATZFINANZIERUNG. Mit der sogenannten „Studienplatzfi nanzierung“ will die Regierung die Unis fi nanziell entlasten. Seit das Regierungsprogramm eine Überarbeitung erfahren hat, ist fi x, dass berechnet werden soll, wie viel ein Studienplatz kostet. Danach soll dann auch entschieden werden, nach welchem Schlüssel die Unis Geld für eben jene Studienplätze bekommen sollen. Vermutlich werden dabei genau so viele „Studienplätze“ herauskommen, wie Budget da ist. Sprich: Flächendeckende Zugangsbeschränkungen und die Reduktion von Studierendenzahlen sollen die Unis „entlasten“. Da die Details noch nicht ausgehandelt sind, hat die zukünftige Bundesvertretungsspitze einige Einfl ussmöglichkeiten. Ob die ÖH allerdings viel verhandeln können wird, ist fraglich. Die meisten Fraktionen lehnen flächendeckende Zugangsbeschränkungen ab. Sowohl Grüne und Alternative Studierende (GRAS), der Verband sozialistischer Student_innen Österreichs (VSStÖ), die Fachschaftslisten (FLÖ) und die beiden kommunistischen Listen KSV-KJÖ und KSV-LiLi fordern stattdessen einen off enen Hochschulzugang, der staatlich fi nanziert werden soll. Die AktionsGemeinschaft (AG) begrüßte die „kapazitätsorientierte Studienplatzfi nanzierung“, lehnt Studiengebühren jedoch ab – Zugangsbeschränkungen nennt die AG „Zugangsmanagement“ und fordert „faire und transparente Aufnahmetests“. Die Jungen Liberalen Studierenden (JUNOS) hingegen sind begeistert von den Ideen des sozialdemokratischen Kanzlers: „Christian Kern setzt mit der Studienplatzfi nanzierung erste richtige Schritte in Richtung fairer Zugangsbeschränkungen.“ Die Fraktion fordert „nachgelagerte Studiengebühren“ in der Höhe von bis zu 500 Euro im Semester, die nach dem Studium bezahlt werden sollen. Der RFS will ausländischen Studierenden nur dann einen Studienplatz gönnen, wenn sie in ihrem Herkunftsland ebenfalls einen vorweisen können, was für Drittstaatenangehörige allerdings bereits Realität ist.
UNIS UND ANDERE HOCHSCHULEN. Seit der letzten Wahl 2015 sind alle Studierenden von Universitäten, Privatunis, Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen Mitglieder der ÖH. Rechtlich gesehen sind sie aber nicht gleichgestellt, da sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen je nach Hochschultyp stark unterscheiden. Während die Regierung keine Pläne hat, einen einheitlichen Hochschulraum zu schaff en, sehen die Listen, die sich zur ÖH-Wahl stellen, das anders. Die GRAS schreibt zum Beispiel: „Das Problem liegt vor allem in den rechtlichen Grundlagen: Welche Rechte Student_innen haben, ob und wenn ja wo sie diese einfordern können, hängt maßgeblich vom Hochschulsektor ab. Bei einem einheitlichen Hochschulraum wären auch Wechsel zwischen den Sektoren wesentlich einfacher und unbürokratischer möglich“, und fasst damit die Meinung fast aller Fraktionen zusammen. Der KSV-KJÖ stellt die Privatuniversitäten jedoch in Frage, „denn von kritischer Lehre und Bildung kann dort nicht die Rede sein“. Der KSV-LiLi will sie nicht weiterhin öff entlich bezuschussen lassen. Die FLÖ betont, „Österreich braucht keinen einheitlichen Hochschulraum, aber ein klares bundesweites Studienrecht für alle Studierenden“. Auch die AG begrüßt den Status quo: „Eine Trennung ist durchaus sinnvoll, da so eine Vielfalt von ‚Systemen‘ erhalten bleibt und man für sich selbst entscheiden kann, welches für einen selbst das beste ist.“
SOZIALE LAGE. Die letzte Studierenden-Sozialerhebung zeigte: Obwohl 61 Prozent der Studierenden erwerbstätig sind, ist über ein Viertel von starken fi nanziellen Schwierigkeiten betroff en. Von der Familie wird nur ein Drittel fi nanziert – somit bleibt die staatliche Studienbeihilfe die wichtigste Unterstützung für Studierende. Erfolgreich ist sie auch: Die Studienabschlussquote ist bei jenen Studis, die eine Beihilfe beziehen, doppelt so hoch wie bei anderen. Die Beträge sind jedoch niedrig und der Kreis der potentiellen Bezieher_innen ist klein. So wundert es wenig, dass auch hier sämtliche Fraktionen Erhöhungen und Änderungen fordern. Dass die Studienbeihilfe seit 1999 nicht mehr an die Infl ation angepasst wurde, ärgert die wahlwerbenden Gruppen ebenso wie die diversen Altersgrenzen, die spätentschlossenen Studierenden das Leben schwer machen. Wie die Beihilfen künftig aussehen sollen, darüber sind die Fraktionen sich jedoch nicht eins: Während JUNOS mehr „Leistungsstipendien“ fordern, will die GRAS ein „existenzsicherndes Grundstipendium von 844 Euro im Monat für alle Student_innen“, der KSV-KJÖ sieht soziale Absicherung nur im Sozialismus als möglich an, FLÖ und AG wollen zusätzlich eine Aufstockung verschiedener Sachleistungen.
MOBILITÄT. In einem Thema sind sich alle Fraktionen, die in die Bundesvertretung wollen, einig: Sie fordern alle ein österreichweit gültiges günstiges Studiticket. Über diese Forderung – und darüber, dass der öff entliche Verkehr für Studierende in anderen europäischen Ländern gratis ist – haben wir in der letzten progress-Ausgabe ausführlich berichtet („Sparschiene“, S. 8). Eine andere Art der Mobilität ist jene zwischen den Hochschulen, sowohl in Österreich als auch im europäischen Hochschulraum. Mit einem FH-Bachelor einen Uni-Master zu belegen ist in der Praxis oft ein sehr steiniger Weg mit vielen Behördengängen. Sowohl VSStÖ als auch JUNOS schlagen deswegen die Schaff ung einer Informationsquelle vor, in der mögliche Anrechnungen und weiterführende Studien dokumentiert werden, die GRAS will diese Frage europaweit geklärt wissen. Bis auf eine Fraktion sind sich alle einig, dass das Bologna-System nicht durchlässig genug ist. Der KSV-KJÖ möchte das System dagegen abschaff en und zurück zu den Diplomstudien. Der KSV-LiLi möchte die Marktlogik des Bologna-Systems bekämpfen und so für mehr Mobilität sorgen.
BARRIEREN. Für eine ganze Reihe Studierender ist der Studienalltag von Barrieren geprägt. Diese können im Falle körperlicher Beeinträchtigungen ganz einfach baulicher Natur sein, andere Barrieren sind nicht so off ensichtlich. Alle Fraktionen begrüßen einen barrierefreien Ausbau der Infrastruktur, in den Details unterscheiden sich die Zugänge jedoch. Der KSV-LiLi sieht Nachholbedarf bei der Barrierefreiheit: „Während in anderen Ländern versucht wird, allen Menschen das Studieren zu ermöglichen, fangen österreichische Hochschulen gerade mal damit an, Aufzüge oder Rampen zu installieren.“ Die FLÖ hingegen ortet vor allem Mangel bei der Beratung und sieht auch die ÖH im Zugzwang: „Die ÖH kann sich dafür einsetzen, mehr Beratungen anzubieten und Anlaufstellen einzurichten.“ VSStÖ und GRAS erinnern daran, dass auch psychische Krankheiten wie Depressionen berücksichtigt werden müssen und fordern alternative Lern- und Prüfungsmodalitäten wie Online-Vorlesungen. Ebenfalls größtenteils unsichtbare Barrieren stellen sich für LGBTIQ-Studierende, vor allem für Trans- oder Inter-Studierende, deren Geschlecht nicht mit der Geschlechtsangabe in ihrem Pass übereinstimmt. Die Initiative #NaGeH fordert, dass Unis künftig unbürokratisch Vornamen und Geschlechtseintrag von inter*, trans und nichtbinären Menschen ändert. Diese Forderungen werden von den meisten Fraktionen geteilt, einzig die FPÖ-Vorläuferorganisation RFS äußert sich auf ihrer Homepage verächtlich über LGBTIQ-Studierende. Binäre Toiletten – also solche, die nach dem klassischen „Mann/Frau“-Schema aufgeteilt sind, nennt der RFS zwar „Unfug“, scheint sich der Bedeutung dieser Aussage jedoch nicht bewusst zu sein. Die AG hat sich nicht zu den Forderungen von #NaGeH geäußert, sieht die ÖH jedoch als zuständige Organisation, bei der sich Studierende bei Diskriminierungen melden könnten.
BILDUNG. Studierende und Hochschule sind nur der letzte Teil der Pipeline des österreichischen Bildungsystems und viele Probleme entstehen an anderer Stelle. Es ist daher wichtig, dass die ÖH einen genauen Blick auf die Reformen im Bildungsystem wirft – alleine schon deswegen, weil sie ja auch die zukünftigen Lehrer_innen vertritt, die momentan studieren. Zu der Frage, wie das Bildungssystem insgesamt organisiert werden soll, halten sich die Fraktionen eher bedeckt – die GRAS fordert aber z. B. die Einführung der Gesamtschule, der KSV-KJÖ will die Schulen demokratisieren. Schüler_innen sollten, da sind sich die Fraktionen einig, besser auf ein Hochschulstudium vorbereitet werden. Die JUNOS sagen dazu: „Der Wert der Bildung muss früh im Schulsystem vermittelt werden“, GRAS, VSStÖ, FLÖ und AG fordern mehr Informationen – das Referat für Maturant_ innenberatung der Bundesvertretung muss sich um seinen Fortbestand also keine Sorgen machen. GRAS und VSStÖ fordern zusätzlich ein Vorstudium, bei dem Fächer ausgetestet werden können, die AG einen freiwilligen Selbsteinstufungstest.
MAHLZEIT. Während in vielen Ländern das Essen in der Mensa zum Studierendenalltag gehört, ist das Angebot in Österreich dürftig und dazu noch recht teuer. Die AG nähert sich hier grünen Positionen an und fordert regionale Speisen. Vegetarische Optionen sind GRAS und KSV-KJÖ wichtig, die JUNOS wollen, dass das Mensapickerl auch bei privaten Gaststätten als Vergünstigung gilt, während der KSV-LiLi ein Problem mit Mensen als Privatunternehmen hat. FLÖ und VSStÖ fordern zusätzlich offene Küchen, in denen Studierende selbstständig kochen können.
ZUSAMMENGEFASST: Die Antworten auf die zukünftigen Fragen der ÖH unterscheiden sich nicht so sehr, wie man es zunächst vielleicht annehmen würde, gerade beim off enen Hochschulzugang jedoch gewaltig. Die Fraktionen haben nicht nur unterschiedliche Zugänge zu Themen, sondern auch zu der Art und Weise, wie sie als ÖH arbeiten wollen. Für Wähler_innen, die bisher wenig Kontakt mit der ÖH hatten, ist dies jedoch schwierig herauszuschälen. Es empfiehlt sich daher, sich umfassend zu informieren, bevor eins zwischen dem 16. und 18. Mai seine Stimme verteilt.
Redaktioneller Hinweis: Die Positionen der Fraktionen wurden mit einem Fragebogen und den jeweiligen Webseiten erarbeitet.
Joël Adami studiert Umwelt- und Bioressourcenmanagement an der Universität für Bodenkultur Wien.