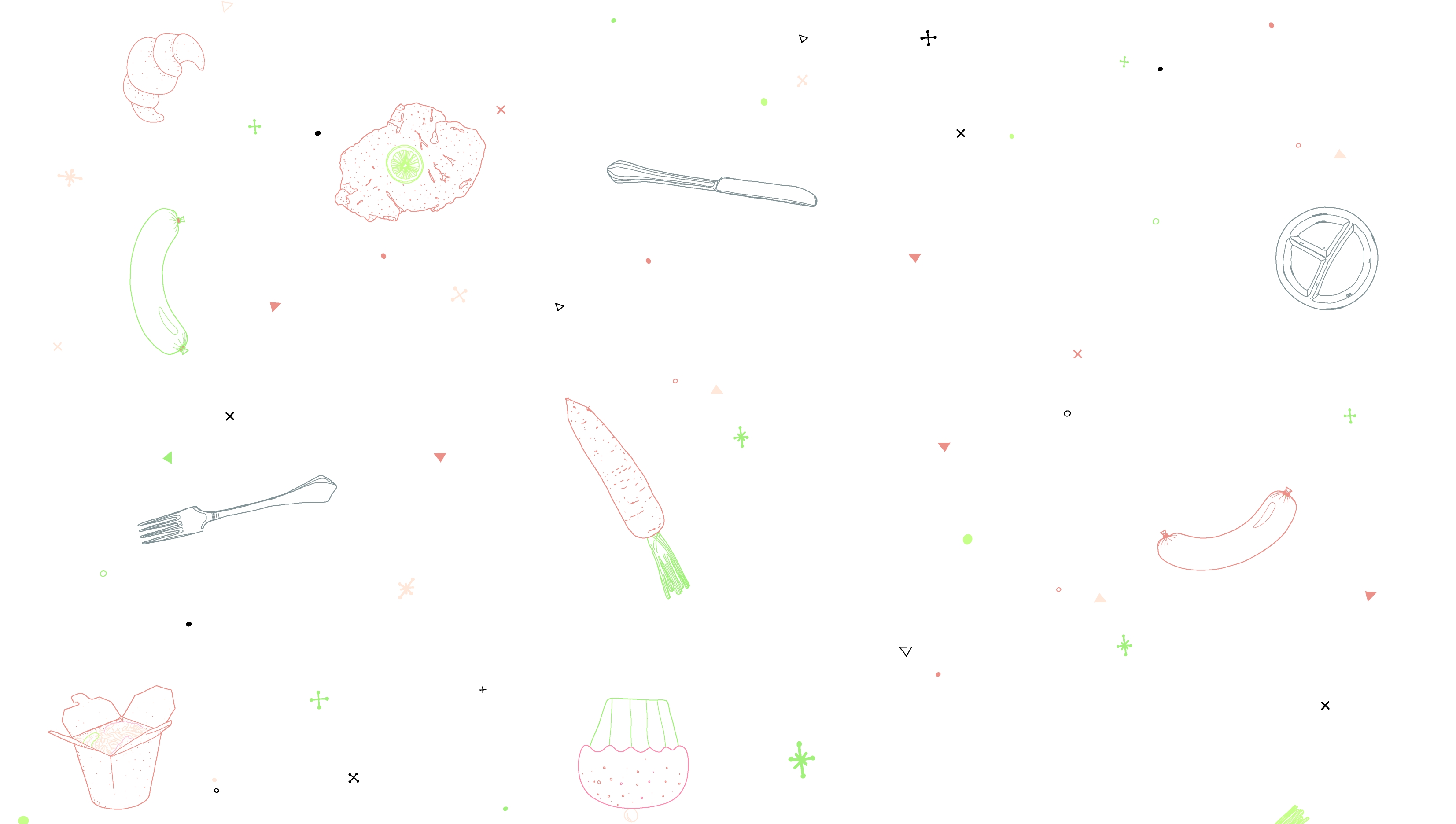Löcher im Rechtssystem stopfen
In der juristischen Ausbildung wird die gesellschaftspolitische Dimension von Recht gerne vernachlässigt. Studentische Rechtsberatung nimmt in Anlehnung an die angloamerikanische Tradition der „Law Clinics“ seit kurzem auch in Österreich soziale Verantwortung wahr.
Vor dem Gesetz sind alle gleich. In der Theorie. In der Praxis haben nicht alle die Ressourcen, bestehende rechtliche Möglichkeiten auszuschöpfen. In den USA schließen an Universitäten angebundene studentische Rechtsberatungsstellen, die so genannten „Legal Clinics“, eine wichtige Lücke im Rechtsschutzsystem. Hierzulande haben solche Institutionen keine Tradition. Felix Kernbichler, David Weixlbraun und Stephan Rihs verorteten vor zwei Jahren dennoch einen Bedarf – auch aufseiten der Studierenden. Sie gründeten nach eigenen Erfahrungen mit „Legal Clinics“ in den Staaten kurzerhand die „Vienna Law Clinics“. Der im Frühjahr mit dem sozialen Innovationspreis SozialMarie ausgezeichnete Verein will mit seiner kostenlosen, niedrigschwelligen Rechtsberatung einen gesellschaftlichen Beitrag für benachteiligte Gruppen leisten.
RECHTSHILFE FÜR START-UPS UND ASLYWERBENDE. Österreich hat grundsätzlich ein gutes Verfahrenshilfesystem. „Grundsätzlich“, wie Anna Wegscheider, die wie viele im „Vienna Law Clinics“-Kernteam ihr Studium längst abgeschlossen hat, extra wiederholt. Das Lieblingswort der Jurist_innen zieht bekanntlich immer ein „Aber“ nach sich: „Die Angebote sind da, aber zum einen ist die Kommunikation schlecht und zum anderen gibt es Menschen, die aufgrund ihrer Position in der Gesellschaft keinen Zugang zu Rechtsschutz haben.“
[[{"fid":"2326","view_mode":"colorbox","fields":{"format":"colorbox","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":"David Weixlbraun von der Vienna Law Clinic. Foto: Cornelia Grobner"},"type":"media","attributes":{"title":"David Weixlbraun von der Vienna Law Clinic. Foto: Cornelia Grobner","height":"253","width":"380","class":"media-element file-colorbox"}}]]
Derzeit fokussieren die „Vienna Law Clinics“ ihre Arbeit auf die aus akademischen Rahmenbedingungen und persönlichem Interesse gewachsenen Bereiche Start-ups sowie Asyl- und Fremdenrecht. Die Arbeitsweisen der beiden je 15-köpfigen Teams könnten nicht unterschiedlicher sein: Während die Start-up-Gruppe persönliche Beratungen zu eigenen Bürozeiten anbietet und angehenden Jungunternehmer_innen rechtliche Erstauskünfte über Gesellschaftsform, Immaterialgüterrecht und Co. erteilt, macht die Asyl-Gruppe keine individuelle Beratung. Sie unterstützt NGOs wie den Verein Ute Bock bei rechtlichen Fragen und kooperiert mit dem Netzwerk AsylAnwalt.
WIN-WIN-SITUATION. Die Arbeit der „Vienna Law Clinics“ wird von Partner-Kanzleien gegengeprüft – ein wesentlicher Punkt der Qualitätssicherung. „Wir haben uns zur Unterstützung entschlossen, weil wir die Idee der studentischen Rechtsberatung toll finden. Nicht umsonst ist dieses Modell bereits seit langer Zeit an internationalen Eliteuniversitäten etabliert“, erklärt Rechtsanwalt Florian Steinhart von Herbst-Kinsky das Engagement der Kanzlei.
Speziell das Asyl- und Fremdenrecht ist besonders komplex, wird in der Ausbildung allerdings vernachlässigt. Auch deswegen findet Rechtsanwältin Julia Ecker, eine weitere professionelle Unterstützerin, das Konzept der Law Clinics „genial“. „Das hätte ich selbst als Studentin gerne gehabt“, so die Fremdenrechtsexpertin. Besonders in der Kooperation mit dem Netzwerk AsylAnwalt sieht sie einen Mehrwert für ihren Arbeitsbereich. So haben die Studierenden zuletzt eine umfassende Recherche für eine Verwaltungsgerichtshof-Judikatur zum Asylrecht erledigt. Ecker: „Das ist toll, denn ein einzelner Anwalt kann nicht hunderte Entscheidungen neben der laufenden Arbeit screenen.“
[[{"fid":"2327","view_mode":"colorbox","fields":{"format":"colorbox","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Teresa Exenberger von der Vienna Law Clinic. Foto: Cornelia Grobner"},"type":"media","attributes":{"title":"Teresa Exenberger von der Vienna Law Clinic. Foto: Cornelia Grobner","height":"253","width":"380","class":"media-element file-colorbox"}}]]
Über mangelnde ehrenamtliche Bereitschaft von Studierenden können sich die „Vienna Law Clinics“ nicht beschweren. Im Gegenteil: Aufgrund des Erfolges überlegt man die Erweiterung um eine Konsument_innenschutz-Gruppe. Das Wechselspiel aus Gemeinwohl und studentischem Nutzen ist das, was die Philosophie von Law Clinics ausmacht. Deshalb laufen derzeit auch Gespräche mit dem Dekanat der Rechtswissenschaftlichen Fakultät über Möglichkeiten, die Arbeit der angehenden Jurist_innen formell im Studium anzuerkennen.
UNTERSCHIEDE. Gelänge die Etablierung dieses Konzepts, wären die „Vienna Law Clinics“ Pioniere in Österreich. Weitere Ansätze gibt es an der Karl-Franzens-Universität in Graz, wo Law Clinics in Form von praxisbezogenen Lehrveranstaltungen, ohne eigentliche Rechtsberatung, umgesetzt werden: Die Grazer „Refugee Law Clinic“ zum Beispiel bietet mehrere Lehrveranstaltungen zum Thema Flüchtlings- und Asylrecht in Zusammenarbeit mit Praktiker_innen sowie Basisinformationen als Flüchtlingsrechts-Kurzguide an. Für die von Eva Schulev-Steindl gemeinsam mit Miriam Karl geleitete „Environmental Law Clinic“ wiederum bearbeiten Studierende in Zusammenarbeit mit NGOs wie dem Umweltdachverband aktuelle Umweltrechtsfälle. „Dies bietet den Studierenden die einzigartige Chance, schon während ihres Jus-Studiums reale Lebenssachverhalte zu behandeln“, so die Professorin. „Dafür müssen sie sich aber auch durch wahre ‚Aktenberge’ wühlen – das Material umfasst teilweise mehrere Gigabyte.“ Und auch eine Legal Clinic für öffentliches Recht und Umweltrecht gibt es in Graz. Sie wird in Kooperation mit der Volksanwaltschaft von Georg Eisenberger geführt: „Mein persönliches Ziel ist es, möglichst vielen Studierenden zu zeigen, wie spannend und fordernd Öffentliches Recht in der Praxis sein kann.“
[[{"fid":"2328","view_mode":"colorbox","fields":{"format":"colorbox","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Anna Wegscheider von der Vienna Law Clinic. Foto: Cornelia Grobner"},"type":"media","attributes":{"title":"Anna Wegscheider von der Vienna Law Clinic. Foto: Cornelia Grobner","height":"253","width":"380","class":"media-element file-colorbox"}}]]
MIT RECHT SOZIALEN WANDEL BEWIRKEN. Die stärkere Institutionalisierung der „Vienna Law Clinics“ brächte für Gründungsmitglied Weixlbraun auch einen gesellschaftlichen Mehrwert: „Durch die Anbindung an die Universität wäre eine akademische Reflexion möglich.“ Wiederkehrende Fragestellungen könnten Rechtsschutzprobleme sichtbar machen und Basis für politische Arbeit sein. Denn die Möglichkeit von strategischer Prozessführung – also über einen starken Einzelfall hinaus, soziale, politische oder rechtliche Veränderungen in Gang zu setzen – funktioniert in Österreich immer wieder gut. Das hat zuletzt das als verfassungswidrig gekippte Adoptionsverbot für homosexuelle Paare gezeigt. Solche Fälle würden beweisen, dass man mit dem Recht als Machtinstrument auch gesellschaftliche Veränderungen bewirken kann, streicht „Vienna Law Clinics“-Juristin Wegscheider heraus. Ihre Kollegin Teresa Exenberger bringt es auf den Punkt: „Hier sehen wir eine wichtige Schnittstelle für Law Clinics: Wir können Ressourcen anbieten, die Kanzleien nicht haben.“
Cornelia Grobner ist freie Journalistin und Doktoratsstudentin im Fachbereich Kommunikationswissenschaft an der Universität Salzburg.
Links:
Vienna Law Clinics
Refugee Law Clinic
Environmental Law Clinic
Legal Clinic für öffentliches Recht und Umweltrecht