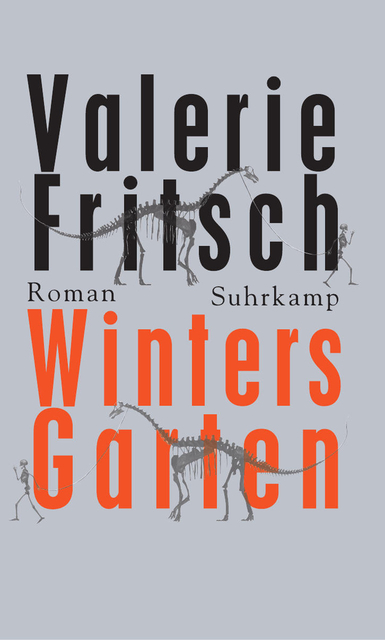Die Gründung der Wiener Frauenhäuser geht zurück auf das Engagement von Sozialarbeits-Studentinnen. Am Sonntag den 24. November feiern die Wiener Frauenhäuser mit einer Matinee im Wiener Volkstheater ihr 35-jähriges Bestehen. progress online hat mit Silvia Samhaber vom Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) gesprochen.
progress: Vor 35 Jahren wurde das erste Frauenhaus in Wien gegründet. Wie kam es dazu?
Silvia Samhaber: Zurück geht die Gründung des ersten Frauenhauses auf ein Projekt der damaligen Sozialakademie. Sozialarbeits-Studentinnnen haben unter der Veranstaltungsleitung von Frau Irmtraut Karlsson dieses Projekt konzipiert. Sie waren fasziniert von der Idee einen Raum zu schaffen, in dem sich Frauen und ihre Kinder vor Gewalt schützen und so der Gewalt entfliehen können. Die Studentinnen haben dann andere Städte besucht, wo schon Frauenhäuser etabliert waren, wie beispielsweise in London, und haben sich angeschaut, wie dort gearbeitet wird. Sie haben es tatsächlich geschafft ein Frauenhaus in Wien zu eröffnen. Was gerade zur damaligen Zeit, wie man sich vorstellen kann, eine ganz, ganz große Leistung war.
Waren es ausschließlich Studentinnen, die das erste Frauenhaus gegründet haben?
Sie hatten zwar großen Rückhalt von Irmtraut Karlsson, die auch SPÖ-Politikerin war und Verbindungen zur Politik mitgebracht hat, aber letzten Endes geht die Eröffnung des ersten Frauenhauses auf das Engagement der Studentinnen zurück.

Gab es große Widerstände gegen die Gründung eines solchen Hauses?
Man muss sich vorstellen, zur damaligen Zeit war Gewalt an Frauen ausgehend vom Partner oder vom Expartner, ein großes gesellschaftliches Tabu. Auch so etwas, wie das Gewaltschutzgesetz, das nach dem Prinzip „wer schlägt, der geht“ funktioniert, gab es damals noch nicht. Es musste also sehr viel Bewusstseinsbildung, sowohl auf politischer Ebene, damit überhaupt die Finanzierung gesichert ist, als auch auf gesellschaftlicher Ebene geschehen.
Nichts desto trotz, wurde das Frauenhaus von Anfang gut angenommen und sehr viele Frauen und Kinder haben Schutz und Unterkunft im ersten Wiener Frauenhaus gefunden. Es hat nicht lange gedauert, bis das zweite Frauenhaus in Wien eröffnet wurde. Mittlerweile gibt es insgesamt vier Frauenhäuser in Wien und 30 in Gesamtösterreich.
Gab es parteipolitisch große Widerstände?
Es war ein sehr steiniger Weg, dass es wirklich als Frauenhaus errichtet werden konnte, in dem dezidiert Frauen aufgenommen werden, die von Gewalt betroffen sind und aus der Familie flüchten. Auch die Prinzipien der Frauenhausarbeit, dass die betroffenen Frauen ausschließlich von Frauen betreut werden, haben zu großen Diskussionen geführt.
Können Sie kurz die Arbeit, die innerhalb der Häuser und rund um die Häuser passiert skizzieren?
Den Mitarbeiterinnen ist es wichtig, dass die Frauen und ihre Kinder im Frauenhaus erstmals wirklich ankommen können. In weiterer Folge richtet sich die Arbeit danach, was eine Frau gerade braucht. Generell bieten die Mitarbeiterinnen Hilfe und Unterstützung in sehr vielen Punkten an. Zum einen die psychosoziale und psychologische Unterstützung, zum anderen juristische Beratung, wenn zum Beispiel eine Scheidung ansteht, ein Obsorge-Verfahren oder wenn Anzeige erhoben wird. In weiterer Folge, wenn es zu einem Prozess kommt, bieten wir auch die Prozessbegleitung an. Es gibt außerdem in jedem Frauenhaus eigene Mitarbeiterinnen, die sich nur mit den Kindern beschäftigen, damit auch die Kinder die Möglichkeit haben, das Erfahrene und Erlebte zu verarbeiten.
Kommen die Frauen durchschnittlich öfter mit Kindern?
Wenn man die Zahlen anschaut, kann schon davon ausgegangen werden, dass der Großteil der Frauen mit ihren Kindern flüchten. Im Vorjahr sind insgesamt 3502 Frauen und Kinder ins Frauenhaus geflüchtet, davon waren 1735 Frauen und 1767 Kinder.
Wie lange bleiben die Frauen durchschnittlich im Frauenhaus?
Auch das ist unterschiedlich. Manche Frauen bleiben nur für einen kurzen Krisenaufenthalt, der in unserer Statistik mit 1-3 Tagen erhoben wird, andere bleiben bis zu einem halben Jahr, der große Prozentsatz bleibt zwischen einem halben Jahr und einem ganzen Jahr.
Vor 25 Jahren ist der Verein AÖF ( Verein Autonome Frauenhäuser Österreich) gegründet worden. Was für Erneuerungen hat das mit sich gebracht?
Der Verein AÖF geht darauf zurück, dass die Mitarbeiterinnen der Frauenhäuser sich zusammenschließen wollten. Zum einen um sich untereinander vernetzen und in ihrer Arbeit besser austauschen zu können, zum anderen aber auch, um gemeinsam an die Öffentlichkeit zu gehen. Mittlerweile ist der Verein ziemlich gewachsen. 1991 ist die Interventionsstelle gegen Gewalt hinzugekommen. Wir veranstalten zwei Mal jährlich die Frauenhaus-Tagungen, bieten Workshops für Schulen an und stellen Infobroschüren her, zum Beispiel über das Gewaltschutzgesetz, oder darüber, welche Gewaltformen es überhaupt gibt und wo man Hilfe bekommen kann. 1994 ist das Europäische Netzwerk gegen Gewalt an Frauen Wave (Women against Violence Europe) dazugekommen, wo auch der AÖF der Träger ist, und 1998 dann die Frauenhelpline.
Auch die Frauenhelpline feiert heuer ein Jubiläum. Erzählen Sie ein bisschen was zu ihrer Entstehung.
Die Frauenhelpline gegen Gewalt gibt es nun seit 15 Jahren und ist eine bundesweite Hotline, die 1998 unter der damaligen Frauenministerin Barbara Prammer als die erste große, österreichweite Frauenhelpline begründet wurde. Eine Hotline ist ein sehr niederschwelliges Angebot. Die Mitarbeiterinnen versuchen herauszufinden, welche Problemfelder es überhaupt gibt, um dann in weiterer Folge zu schauen, wie man die Frauen am besten in ihrem Weg raus aus der Gewalt unterstützen kann. Die Mitarbeiterinnnen sind an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr erreichbar. Sie beraten auch mehrsprachig auf türkisch, arabisch, bosnisch, kroatisch, serbisch, englisch und rumänisch. Die Zielgruppe sind in erster Linie Frauen und Mädchen, die von Gewalt betroffen sind, aber es rufen auch Angehörige von Gewalt-betroffenen Frauen an, die sich erkundigen, wie sie helfen und unterstützen können.
Hat sich das Bewusstsein für die Hotline im Laufe der letzten fünfzehn Jahren verbessert?
Wir hoffen natürlich sehr, dass die Hotline nach fünfzehn Jahren eine Stelle ist, die sich etabliert hat. Viele Beratungseinrichtungen, vor allem Frauenberatungseinrichtungen, haben die Nummer auf ihrer Website.
Stichwort Männerberatung: Gibt es da eine Art von Zusammenarbeit?
Ja, es ist uns wichtig, dass da ein reger Austausch existiert. Es gibt auch ein Netzwerk, das sich zur Täterarbeit austauscht, in dem natürlich auch die Männerberatungen vertreten sind und auch bei der Plattform gegen Gewalt in der Familie ist die Männerberatungsstelle vertreten. Es ist uns ein großes Anliegen, dass die Männerberatungen finanziell besser unterstützt werden und Anti-Gewalt-Trainings österreichweit finanziert werden.
Stichwort Väterechtsbewegung: Haben sich in den letzten Jahren im Hinblick auf die Väterrechtsbewegung Probleme aufgetan, die es davor nicht gegeben hat?
Man hat zu Wahlkampfzeiten recht stark bemerkt, dass gerade die Väterrechtsbewegung versucht hat, sich zu positionieren und ihre Anliegen noch mehr nach außen zu tragen. Beispielsweise, wenn es um den Rechtsbereich und ums Obsorgerecht geht, gibt es Strömungen, die versuchen ihre gesellschaftspolitischen Vorstellungen zu Wahlkampfzeiten noch stärker einzubringen.
Wie ist die derzeitige Situation der Frauenhäuser? Politisch und finanziell?
Die Finanzierung der Frauenhäuser ist Ländersache, dementsprechend ist auch die Finanzierung der Frauenhäuser von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich. In manchen Bundesländern ist die Finanzierung halbwegs gesichert, in anderen Bundesländern schaut es prekärer aus. Wir hören immer wieder, dass zum Beispiel Übersetzungskosten nicht so gedeckt werden, wie sie sollten, oder, dass es mehr Mitarbeiterinnen in den Frauenhäusern brauchen würde. Die Situation ist demnach also sehr abhängig vom jeweiligen Bundesland. Wir sind natürlich auch gespannt, was die neue Regierung mit sich bringen wird und hoffen auf große Unterstützung der Gewaltschutzarbeit.
Was würden Sie sich für die Zukunft wünschen?
Wir würden uns wünschen, dass eine Bundesländer-übergreifende Aufnahme in die Frauenhäuser möglich wird. Auf Grund der unterschiedlichen Finanzierung ist das bis jetzt nicht möglich. Es gibt aber Fälle, wo es aus Sicherheitsgründen für die Frauen und Kinder notwendig wäre. Es ist wünschenswert, dass es, wenn die Gefährdung im eigenen Bundesland zu groß ist, in naher Zukunft machbar wird zu überstellen.
Welche aktuellen Projekte sind angedacht?
Am 25. November starten die Tage gegen Gewalt. Das ist eine internationale Kampagne gegen Gewalt an Frauen und Mädchen, bei der wir jedes Jahr sehr aktiv dabei sind. Im Zuge dessen veranstalten wir eine Filmnacht und bieten eine Ringvorlesung mit dem heurigen Themen-Schwerpunkt „Gewalt an älteren Menschen“ an. In der Vorlesung werden sowohl rechtliche Aspekte beleuchtet, als auch medizinische, soziologische, philosophische und ethische. Am 28. November veranstalten wir einen Poetry Slam und auf der Website „Der Wunschzettel der Frauenhäuser“ können Mitarbeiterinnen der Frauenhäuser und Frauen und Kinder, die in einem der Frauenhäuser leben, ihre Wünsche aufschreiben. Man kann die Website besuchen und vielleicht ja den einen oder anderen Wunsch erfüllen.

Am 24. November ist die große Benefiz-Matinee „gestern für heute für morgen“. Wie werden die Jubiläen 35 Jahre Wiener Frauenhäuser, 25 Jahre AÖF und 15 Jahre Frauenhelpline gefeiert?
Am Vormittag findet im Volkstheater die Matinee statt, wo unter anderem die Nationalratspräsidentin Barbara Prammer, die insofern mit den Frauenhäusern recht eng verbunden ist als dass sie die Frauenhelpline initiiert hat und bei der Gründung vom Linzer Frauenhaus eine wichtige Rolle gespielt hat, die Laudatio halten. Zwei der Gründerinnen, Rosa Logar und Irmtraut Karlsson werden in einer Art Doppel-Conference miteinander sprechen und erzählerisch zurückblicken. Sybille Hamann wird eine Podiumsdiskussion moderieren, an der unter anderem Irmtraut Karlsson, Adele Neuhauser, Christoph Feuerstein und der Polizei Vizepräsident Karl Mahrer, der schon seit vielen Jahren ein wichtiger Unterstützer der Frauenhaus-Arbeit ist und für die Etablierung des Gewaltschutzgesetzes wichtig war, teilnehmen. Die Autorin Julya Rabinowich wird einen Text lesen und die Rounder Girls werden gesangliche Stücke darbieten.
Am Nachmittag gibt es auch noch in der Roten Bar und im Weißen Salon Veranstaltungen. Mika Vember spielt gemeinsam mit einer Akkordeonistin, zeitgleich sind im Weißen Salon die Leiterinnen der vier Wiener Frauenhäusern vertreten, die vom Jetztstand berichten. Später wird die Schauspielerin Pia Hierzegger ein szenisches Interview mit dem Leiter der Männerberatungsstelle Romeo Bisutti und Berivan Aslan von den Grünen führen. Außerdem gibt einen Büchertisch und einen Infotisch, wo die Leute mit den Mitarbeiterinnen ins Gespräch kommen können.
Benefiz-Matinee: 35 Jahre Frauenhäuser, 25 Jahre Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser, 15 Jahre Frauenhelpline gegen Gewalt
Autonome Österreichische Frauenhäuser