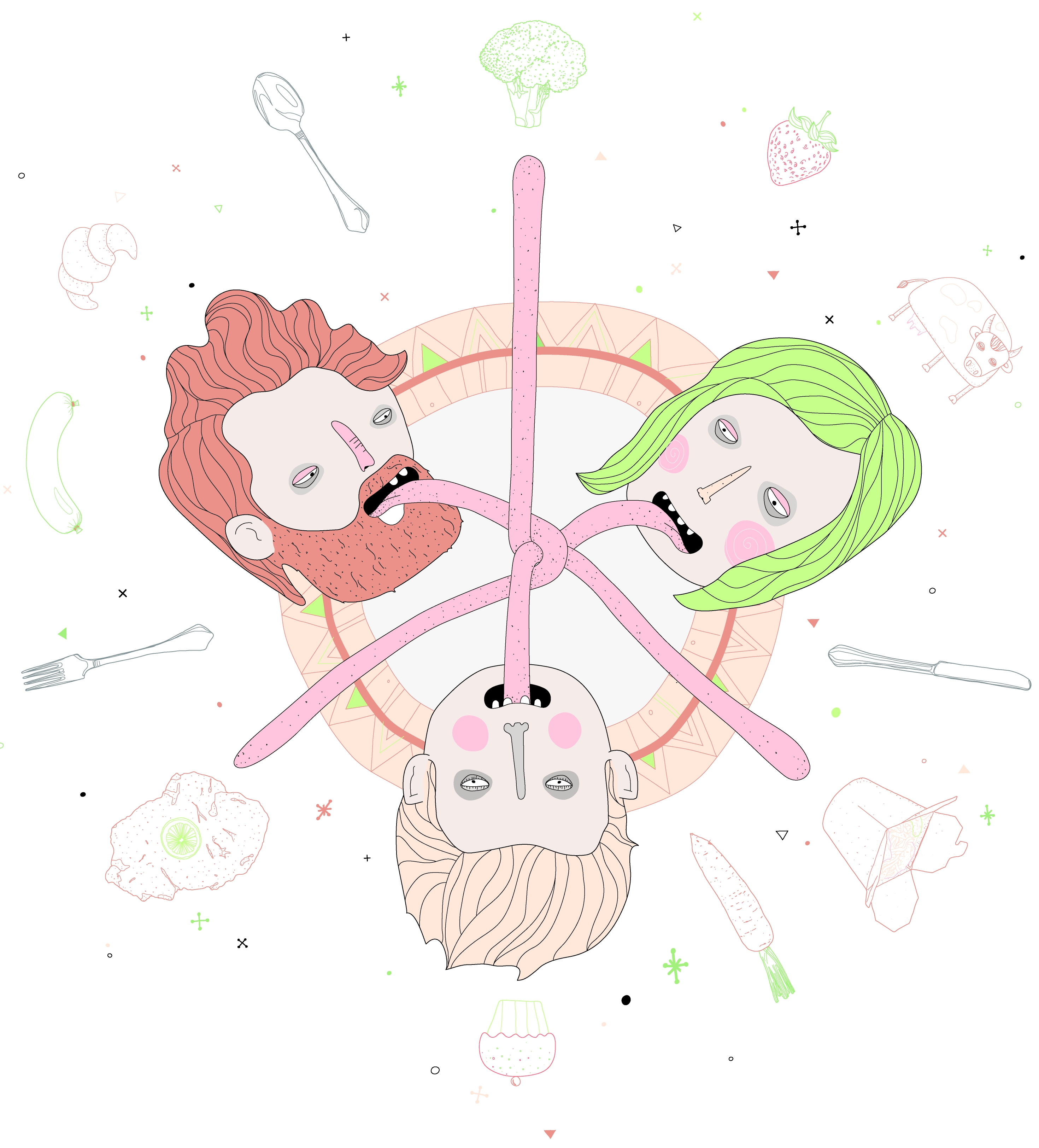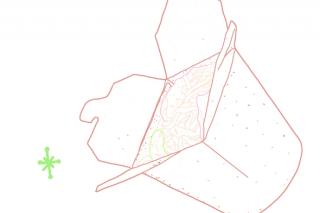Aktivist_innen stecken Zeit, Arbeit und eventuell auch Geld in die Realisierung von Projekten und Veränderungen. Doch manchmal geben sie zu viel, um die Welt zu retten. progress hat mit Aktivist_innen über Burnout, Überlastung und fehlende Anerkennung gesprochen.
Mahriah berichtet über Prozesse und Repression, die Antifaschist_innen erfahren. Auf Twitter und Facebook teilt sie Infos über Abschiebungen und organisiert Treffen für Netzfeminist_innen, kurz: Mahriah ist politische Aktivistin. „Über einen Freund habe ich 2008 von den Prozessen gegen zehn Tierschützer_innen, die in U-Haft waren, erfahren. Der hat mich zum Landesgericht mitgenommen, das war meine erste Kundgebung. Seitdem bin ich aktiv.“ Für Mahriah gibt es immer was zu tun. Sie gündete prozess.report mit, organisiert das femcamp Wien mit, hält Verschlüsselungs- sowie Netzfeminismusworkshops, ist bei der Initiative für Netzfreiheit dabei und macht sonst noch „1.000 andere Dinge“. Irgendwann wurde ihr jedoch alles und „1.000 andere Dinge“ zu viel. „Ich habe lange nicht gemerkt, dass ich an einem Burnout leide.“
Julia Freidl vom Vorsitzteam der ÖH-Bundesvertretung (BV) begann ihr Studium an der Wirtschaftsuniversität Wien. Politisch aktiv wurde sie, weil sie die Studieneingangsphase (StEOP) als unfair empfand und das ändern wollte. Als Teil des Vorsitzteams weiß sie, was Stress bedeutet und kennt auch das Gefühl der Überlastung. „Ich arbeite ehrenamtlich 60 Stunden in der Woche neben dem Studium. Gerade in der Prüfungszeit kann das sehr anstrengend werden.“
Aus Wut auf den Rassismus der schwarz-blauen Regierung und ihre konservativen Bildungspolitik ging Aaron Bruckmiller mit vierzehn zum ersten Mal auf eine Demonstration. Seitdem kämpft er „für eine andere, schönere Gesellschaft“ und ist heute bei der Interventionistischen Linken (iL) in Berlin und Blockupy aktiv. Dass Aktivist_innen manchmal zu viel geben, liegt für ihn auf der Hand. „Wer wie ich ehrenamtlich und in außerparlamentarischen Gruppen aktiv ist, fühlt sich immer wieder überfordert. Schließlich müssen wir unsere politische Arbeit neben unserem Job, Studium oder unseren Kindern tun.“
Selbstausbeutung in ehrenamtlichen Tätigkeiten ist keine Seltenheit. Lisa Tomaschek-Habrina vom Institut für Burnout und Stressmanagement weiß, dass das ehrenamtliche Engagement seine Tücken hat. Nicht nur, weil der monetäre Ausgleich fehlt: „Wenn das Arbeitsaufkommen mit den Ressourcen im Gleichgewicht ist, kann man ein Ehrenamt Jahrzehnte lang machen, ohne dass etwas passiert. Kippt diese Waage und die Belastung überwiegt, kann man es mit den eigenen Ressourcen nicht mehr ausgleichen.“
DICKE HAUT. Im politischen Aktivismus bereitet Abgrenzung oft besondere Schwierigkeiten: Man steht mit seinem Gesicht und Namen für eine Sache, das Engagement ist Sinnbild persönlicher Hoffnung. Reagierten das politische System und die Öffentlichkeit gar nicht oder negativ auf den eigenen Einsatz, trifft das direkt ins Mark des_r Engagierten.
Julia Freidl kennt es, dass Anerkennung und Wertschätzung ausbleiben oder gar negative Rückmeldungen sie erreichen. Als Mitglied des Vorsitzteams der ÖH steht sie genauso wie die anderen Mitglieder des Teams nicht selten unter Kritik von Seiten Studierender, Medien oder auch politischer Fraktionen. „Man lässt sich eine dicke Haut wachsen. Aber leicht ist es nicht. Nicht alles, was du tust, bekommen alle Studierenden automatisch mit.”
Eine besondere Möglichkeit, die eigene politische Arbeit sichtbar zu machen, bietet das Internet. Laut Christopher Hubatschke, wissenschaftlicher Assistent am Institut für Politikwissenschaften der Universität Wien, ist es nicht verwunderlich, dass Aktivist_innen das Medium Internet früh für sich entdeckt haben. „Politischer Widerstand hat sich quer durch die Geschichte dadurch ausgezeichnet die neusten Technologien zu vereinnahmen. Schließlich geht es um die Verbreitung von Information und Gegenöffentlichkeit. Das Internet eignet sich besonders gut, um die eigene Position darzustellen und Solidarität aufzubauen.”
Mahriah benutzt seit Beginn ihrer politischen Arbeit Twitter und Facebook und würde sich auch als Netzaktivistin bezeichnen. Das erste, was sie nach dem Aufwachen – noch vor einem Kaffee – tut, ist ihre Mails zu checken. Aktivismus und Internet gehen für Mahriah Hand in Hand.
TOPFHOTLINE. Christopher Hubatschke setzt sich in seiner Dissertation theoretisch mit Protest- und sozialen Bewegungen in Verbindung mit neuen Technologien auseinander. Da er aber auch bei #unibrennt dabei war, kennt er auch die praktische Seite. Er schwärmt von den Möglichkeiten, die das Internet bietet, um Aktivismus vor Ort zu unterstützen. „In der Volxküche hat uns mal ein Topf gefehlt. Wir haben das auf unseren Social-Media-Kanälen gepostet. Innerhalb von 20 Minuten hat uns jemand einen Topf vorbeigebracht.“ Vor der Allmachtfantasie, dass das Internet von selbst Demokratie und Freiheit bringen würde, warnt Hubatschke jedoch. „Auch im Netz müssen Strukturen, Organisation und Kommunikationswege von Aktivist_innen aufgebaut werden.”
In Zeiten von Blogs, Social Networks und anderen Wortmeldeplattformen braucht man nicht mehr unbedingt auf die Straßen zu gehen, um etwas zu bewirken. Ein Klick, Like oder Post lässt sich bequem vom Smartphone absenden und schon kann man sich zum Team Weltrettung zählen. Die Vorteile liegen auf der Hand. Onlineaktivismus ist wesentlich kostengünstiger. Er ist spontan, schnell und nicht an Raum und Zeit gebunden. Jede_r kann. Immer. Von überall.
Mahriah weist auf die Besonderheit des Internets hin, als Aktivist_in rund um die Uhr etwas tun zu können. „Wenn andere Leute schlafen gehen, gibt es tausend andere Leute, die gerade was tun. Du kannst dich gut beschäftigen und das lenkt auch effektiv vom Burnout ab.“ Auf die Frage, wie viele Stunden sie vor dem Computer verbringt, kann sie keine eindeutige Antwort geben. „Es ist sehr schwer für mich einzuschätzen. Seitdem ich mein Smartphone habe, bin ich rund um die Uhr online.“
ENEMY’S WATCHING. Sich oft und viel im Netz zu bewegen bedarf auch etwas an Vorsicht. Die Gesetzeslage bezüglich Onlineaktivismus ist nach wie vor uneindeutig. So etwas wie Demonstrationsrecht wird nicht gesichert. Die Blockade von Webseiten kann, muss aber keine Folgen nach sich ziehen. Hubatschke, Aaron und Mahriah wissen, dass es als Onlineaktivist_in notwendig ist, sich vor staatlicher Repression und Überwachung zu schützen. „Es ist klar, dass die Polizei auf Twitter und Co mitliest. Man versucht sich zu schützen, indem man nicht jede Information teilt oder nicht unter dem Klarnamen postet. Ich versuche egal welche Information verschlüsselt zu senden“, sagt Mahriah.
Aber auch im Sinne der Selbstausbeutung und Verletzlichkeit bringt der Cyberaktivismus Nachteile. So können Hassmails und Shitstorms persönlicher und kräftiger auf eine_n niederpeitschen. „Als Blockupy-Pressesprecher habe ich ein paar Fernsehinterviews gegeben, die zu einem kleinen Shitstorm im Internet führten. Neben Morddrohungen erreichten mich Empfehlungen nach Nordkorea, zum IS oder in einen PR-Kurs zu gehen. Als ich das zum ersten Mal las, musste ich mehrmals schlucken.“, erzählt Aaron. Die Unmittelbarkeit verlangt prompte Reaktionen bei gleichzeitigem Mangel an Schutz und Struktur. Für Mahriah ist es besonders schwierig, sich aus Onlinediskursen auszuklinken oder mal das Handy abzuschalten.
I’M A CREEP. Für das Ausbrennen spielen neben privaten Belastungen auch Persönlichkeitsfaktoren eine ebenso große Rolle. Gefährdet, sich für eine Sache bis zur Erschöpfung zu verausgaben, sind vor allem Menschen, die nicht wissen, wann „perfekt“ perfekt genug ist, oder alle Aufgaben stets sofort erfüllen möchten. Gerade im Bereich des politischen Engagements, das 24 Stunden am Tag einnehmen kann und wo Geschehnisse oft eine sofortige Reaktion verlangen, ist ein Vertagen auf morgen, das oftmals gesundheitsfördernd wäre, nicht möglich.
Auch für Mahriah ist es nicht leicht, sich auszuklinken. „Mir fällt es ehrlich gesagt sehr schwer, mal eine Pause zu machen. Allein wie viel Zeit wir in den letzten Monaten, in denen wir prozess.report gegründet haben, investiert haben. Wir waren ständig in Gerichtssälen, sind von einem Prozess zum nächsten und haben uns keine Pause gegönnt. Das hat auch zu dem Burnout geführt, an dem ich gerade arbeite.“ Die Erschöpfung kann sich dann auf körperlicher und geistiger Ebene manifestieren, erklärt Tomaschek-Habrina. Von Beschwerden im Verdauungstrakt über Konzentrationsschwierigkeiten bis hin zu depressiven Stimmungen oder Angstzuständen reichen die Symptome einer Überlastung.
Nach einer Zeit der intensiven Prozessberichterstattung bemerkte Mahriah, dass sie nicht mehr so fit war und immer häufiger krank wurde. Auch fiel ihr auf, dass sie weniger schaffte als früher. „Ich war phasenweise eher erschöpft. Dann hab ich eine Pause gemacht, aber ich hab das nie als Burnout anerkannt, sondern hab’ mir gedacht, ich hab’s etwas übertrieben. Ich habe mir zwar nach den Urteilen eine Auszeit gegönnt, aber das hat nicht ausgereicht.“ Erst durch viele Gespräche mit anderen Aktivist_innen, die auch ein Burnout durchmachen oder durchgemacht haben, konnte sie ihren Schwierigkeiten einen Namen geben: Burnout.
POLITISCHE HERZEN. Laut Tomaschek-Habrina ist es wichtig, Warnsignale früh genug zu erkennen und für sich selbst zu sorgen: mittels ausreichender Bewegung, Entspannung, guter Ernährung, Psychohygiene und sozialen Kontakten. Für Mahriah sind es vor allem Freund_innen aus dem Netz, die sie auffangen und von denen sie sich Unterstützung holen kann. „In Wien kann man beim Netzfeministischen Bier oder femcamp über Hasspostings oder solche Dinge reden. Der Vorteil vom Netzaktivismus ist ja: Wenn man es gerade nicht schafft, kann man das Internet abschalten. Aber dann ist man nicht mehr Teil des Diskurses. Das fällt mir manchmal schwer. Aber es funktionert ganz gut, um sich wieder Energie zu holen.“ Aaron nimmt sich auch mal eine Auszeit vom Aktivismus: „Wenn ich mich ausgebrannt fühle, schiebe ich alles von mir, treffe mich mit netten Leuten, gehe tanzen, schaue stundenlang Serien oder lese ein gutes Buch.“
Auf Mahriahs Laptop klebt ein Sticker, auf dem steht: „Unsere Herzen sind politisch.“ Ob sie schon mal daran gedacht hat, ihre Aktivist_innenarbeit aufzugeben? „Nein! Es macht natürlich auch sehr viel Spaß, auch wenn es frustriert. Man lernt tolle Menschen kennen und man macht Erfahrungen. Ich liebe ihn einfach, den Aktivismus. Ich könnte mir das gar nicht vorstellen, diese Arbeit zu beenden.“ Auch Julia möchte ihre Erfahrungen, auch wenn es mal frustrierend ist, nicht missen. Für Aaron muss Aktivismus aber irgendwann ohne Selbstausbeutung möglich sein: „Kein Aktivismus ist auch keine Lösung. Wir kämpfen gegen die Grobheit des Kapitalismus und für eine zärtliche Gesellschaft. Dieser Kampf schließt den zärtlichen Umgang mit sich selbst ein.“
Marlene Brüggemann studiert Philosophie an der Universität Wien.
Alisa Vogt studiert Psychologie und Germanistik an der Universität Wien.