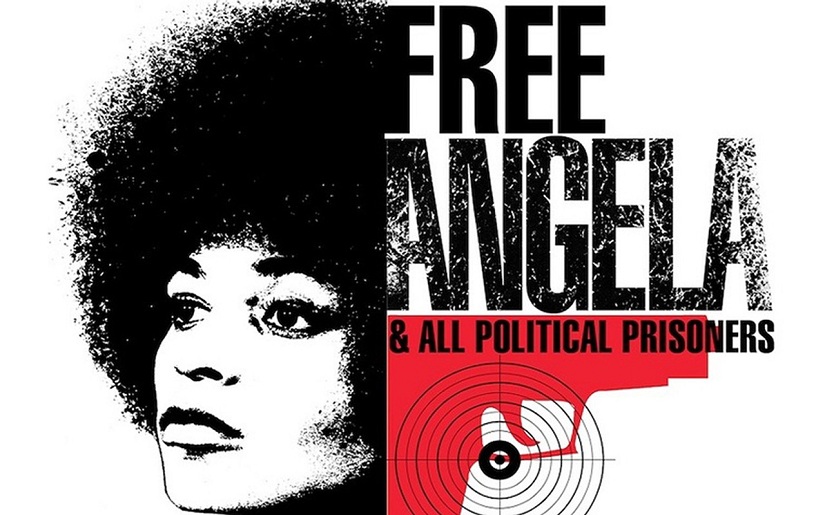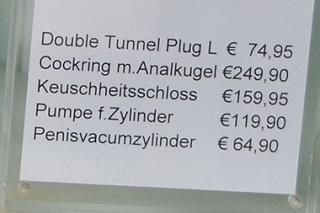Exarchia: Terrornest oder gelebte Utopie?
Um keinen anderen Teil Griechenlands ranken sich so viele moderne Mythen wie um Exarchia, einem anarchistisch geprägten Viertel in Athen. Was ist Exarchia nun tatsächlich: Terrornest oder gelebte Utopie? Manu Banu und Didi Diskovic vermitteln unseren Lesern für progress-online einen Einblick in das „Anarchoviertel“ Athens und dessen Bewohner_innen.

Um keinen anderen Teil Griechenlands ranken sich so viele moderne Mythen wie um Exarchia, einem anarchistisch geprägten Viertel in Athen. Was ist Exarchia nun tatsächlich: Terrornest oder gelebte Utopie? Manu Banu und Didi Diskovic vermitteln unseren Lesern für progress-online einen Einblick in das „Anarchoviertel“ Athens und dessen Bewohner_innen.
Fünfzehn Jahre lang hatte die Athener Regierung versprochen, ein leerstehendes und mit Bauzäunen abgesperrtes Gelände im Stadtviertel Exarchia zu einem Park zu machen. Als es schließlich zu einer Parkgarage werden sollte, reichte es den Einwohner_innen: am 7. März 2009 rissen sie die Absperrungen nieder, bohrten Löcher in den Beton und pflanzten Bäume. Die Aktion wurde quer durch alle Altersgruppen mitgetragen, bei der Entstehung des Parks halfen Student_innen, Arbeiter_innen und Arbeitslose, Jugendliche, Familien und Pensionist_innen mit.
Dieser breiten Solidarität konnten weder Regierung noch Polizei etwas entgegensetzen: Heute ist der Navarino-Park der erste selbstverwaltete Park Griechenlands, eine kleine Oase im ansonsten dichtverbauten Athen. Im Mai 2014 wurde sein fünfjähriges Jubiläum gefeiert: mit Theater, Live-Musik, Tanz und einer Menge Wein.


Geschichten aus dem Widerstand
Diese Episode steht nur stellvertretend für die Widerständigkeit von Exarchia, die ihm auch den Spitznamen „Anarchia“ eingebracht hat. Seinen Ruf erwarb sich der kleine Stadtteil bereits in den frühen 1970er Jahren, als das kleine, an das Polytechnio (Technische Universität) grenzende und studentisch geprägte Viertel zu einem Ort des Widerstandes gegen die Diktatur der rechtsgerichteten Militärjunta wurde. Am 14. November 1973 verbarrikadierten sich Student_innen am Hochschulgelände, installierten einen Radiosender und riefen zum Kampf auf.
Drei Tage später durchbrach ein Panzer des Obristenregimes das Eingangstor, Soldaten stürmten das Polytechnio. Die Niederschlagung des Aufstandes kostete 24 Zivilist_innen das Leben und war gleichzeitig der Anfang des Endes der Diktatur, die nach diesem Gewaltexzess auch die letzte Unterstützung verloren hatte und nur wenige Monate später stürzte.

Ein weiteres Kapitel in der Geschichte des Stadtteils wurde am 6. Dezember 2008 geschrieben, als der 15-jährige Alexandros Grigoropoulos in Exarchia von einem Polizisten erschossen wurde. In der Folge kam es zu einer spontanen Revolte in Athen, die sich bald auf ganz Griechenland ausweitete. Unzählige Polizeistationen, Luxusboutiquen und Banken gingen in Flammen auf. Getragen wurde der Aufstand zu einem großen Teil von Schüler_innen, die sich davor noch nie politisch betätigt hatten.
Nach etwa drei Wochen, kurz vor Weihnachten, beruhigte sich die Lage wieder. Der Mörder wurde später zu lebenslanger Haft verurteilt. Alexandros Grigoropoulos wurde zu einer Art Ikone der griechischen Anarchist_innen, sein Bild ist auf den Wänden Athens allgegenwärtig.

Selbstorganisation, Solidarität und Nachbarschaftshilfe
Exarchia ist aber weit mehr als die Aufzählung seiner Kämpfe. Es gehört vielleicht nicht zu den schicksten, aber zu den lebendigsten Gegenden Athens. Wer durch die Straßen Exarchias geht, findet zahlreiche kleine Buchhandlungen neben Tavernen und Bars, unzählige Stekia (soziale Zentren), politische Räume und sogar ein veganes Geschäft – Letzteres eine Rarität in Griechenland. Gegen die vermeintlichen Segnungen der neoliberalen „Stadtteilaufwertung“ hat man sich bis jetzt erfolgreich gewehrt: Luxusbauten, große Supermärkte oder Geldautomaten sucht man hier vergeblich.
Der Mittelpunkt des Viertels ist der Platia Exarchion, wo häufig Open-Air-Konzerte und Solidaritäts-Veranstaltungen stattfinden. Zu jeder Tageszeit sitzen hier junge und nicht mehr ganz so junge Menschen, plaudern und trinken Bier. In der Luft liegt ein süßlicher Geruch. Die Arbeitslosigkeit ist, wie überall in Griechenland, hoch – doch gerade während der Wirtschaftskrise wurde Exarchia zu einem Paradebeispiel für Solidarität und Nachbarschaftshilfe.


Wer sich von der rot-schwarzen Anarcho-Flagge über dem Eingang des Nosotros nicht abschrecken lässt, kommt in den Genuss der vielbesungenen griechischen Gastfreundschaft und kann sich zwischen Essen zum Selbstkostenpreis, Lesungen, Konzerten und Yoga entscheiden. Im VOX, einem besetzten ehemaligen Kino, können sich Menschen ohne Krankenversicherung kostenlos untersuchen lassen. Das Initiativen-Komitee der Anrainer_innen Exarchias (C.I.R.E.) wiederum kümmert sich um Projekte wie die Betreuung des Navarino-Parks oder die Organisation von Tausch- und Schenkbazaren. Ihre erste Aktion erfolgte vor einigen Jahren, als Telefonanbieter zahlreiche legale und illegale Antennen in Exarchia anbrachten.
Nach einer Krisensitzung montierten Mitglieder des Komitees vier Antennen, die sich in der Nähe von Wohnhäusern und Schulen befanden, kurzerhand wieder ab – dieser Fall wurde von einem Gericht zugunsten von C.I.R.E. entschieden. Heute kümmert sich das Komitee weiterhin um die alltäglichen Probleme der Nachbarschaft, die in regelmäßigen offenen Versammlungen besprochen werden. Selbstorganisation wird in Exarchia groß geschrieben.

Nazifreie Zone
Jeder Zentimeter der Hauswände ist mit Plakaten, Grafitti und politischen Botschaften übersäht – die widerständige Geschichte Exarchias hat sich in das Straßenbild eingeschrieben. Aber auch die Migration hat das Bild Exarchias stark geprägt. „Die Migrant_innen haben das Nachbarschaftsgefühl zurückgebracht. Sie haben einfach ihre Stühle vor die Haustür gestellt, um mit den Mitmenschen zu kommunizieren“, wie ein Einwohner Exarchias erzählt. Diese Nachbarschaftlichkeit erweist sich in der Krise als großer Vorteil: Während in anderen Gegenden Athens rassistischen „Straßensäuberungen“ durch Polizei und rechtsextreme Gruppierungen stattfinden, ist man in hier auf sicherem Terrain. „Hier ist man geschützt, denn den Nazis ist klar: Wenn sie in Exarchia auftauchen, sitzen sie tief in der Scheiße“.
Auch die notorisch rechtslastige Polizei lässt sich hier kaum blicken. Noch vor wenigen Jahren, nach dem Aufstand im Dezember 2008, befand sich Exarchia in einer Art Belagerungszustand: Sämtliche Zufahrtstraßen zum Viertel wurden von Polizisten in Kampfmontur bewacht, Razzien waren an der Tagesordnung. Heute kann davon, von einigen Provokationen und Scharmützeln abgesehen, keine Rede mehr sein. Diese relative Sicherheit zieht viele neue Einwanderer_innen in diesen Stadtteil. Das Diktyo, ein Netzwerk für Immigrant_innen und Flüchtlinge, bietet ihnen neben sozialer und rechtlicher Betreuung auch kostenlose Griechisch- und Computerkurse an. Weiters stehen im „Immigrant_innen-Steki“ regelmäßig Feste, kollektives Kochen oder Theateraufführungen am Programm.


Terrornest oder gelebte Utopie?
Aber nicht nur das freundschaftliche Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Herkunft scheint hier zu funktionieren, auch die Durchmischung aller Altersgruppen ist auffallend. In Lokalen, Squats, Stekia und im Park findet man gleichermaßen Teenager wie auch ältere Menschen. „Als die Polizei hier gegen junge Anarchisten vorging, hat eine Oma aus ihrem Fenster einen Kübel Wasser auf die Polizisten geschüttet und ihnen nachgerufen, sie sollen die Kinder in Frieden lassen“, erzählt eine Bewohnerin Exarchias.
Alle scheinen sich hier zu kennen. Schon nach wenigen Tagen fühlt man sich irgendwie zu Hause und hat sein Stammlokal. „Wenn wir etwas Neues erleben wollen, gehen wir auf die gegenüberliegende Seite des Platzes“, scherzt die 28-jährige Katerina, die schon seit ihrer Kindheit hier lebt. Allem revolutionären Gestus zum Trotz kann Exarchia auch das Flair eines Dorfes haben. Es ist weder das Terrornest, zu dem es von rechtskonservativen Medien gerne hochstilisiert wird, noch eine Realität gewordene Utopie. Inspirierend sind die Kreativität, die Solidarität und die Widerständigkeit der Einwohner_innen allemal.

Dieter Diskovic und Manu Banu studieren Kultur- und Sozialanthropologie an der Universität Wien und engagieren sich bei der Screaming Birds Aktionsgruppe. In den nächsten Wochen werden sie noch ausführlich über die Situation in Griechenland und die solidarischen Initiativen der Griech_innen berichten.