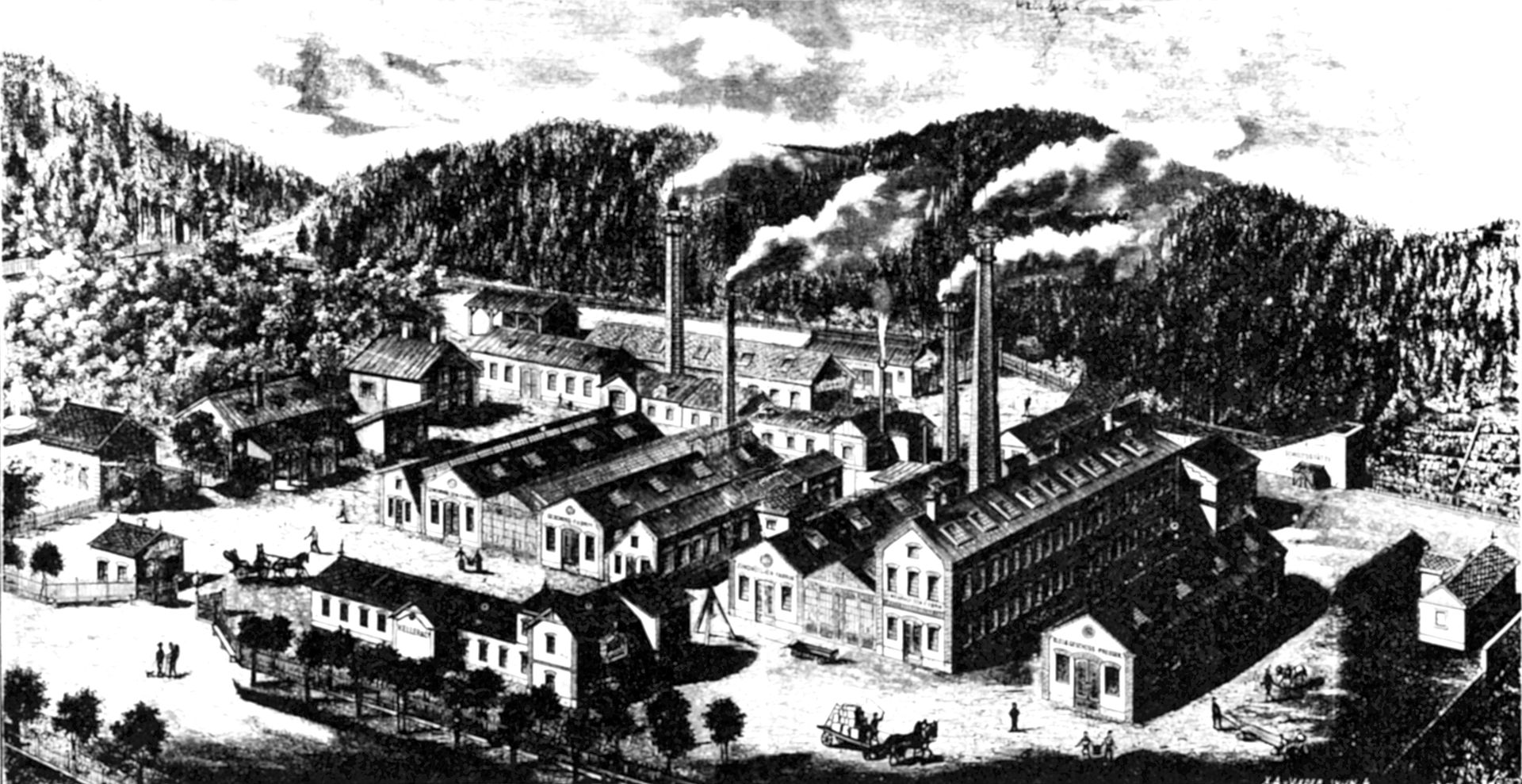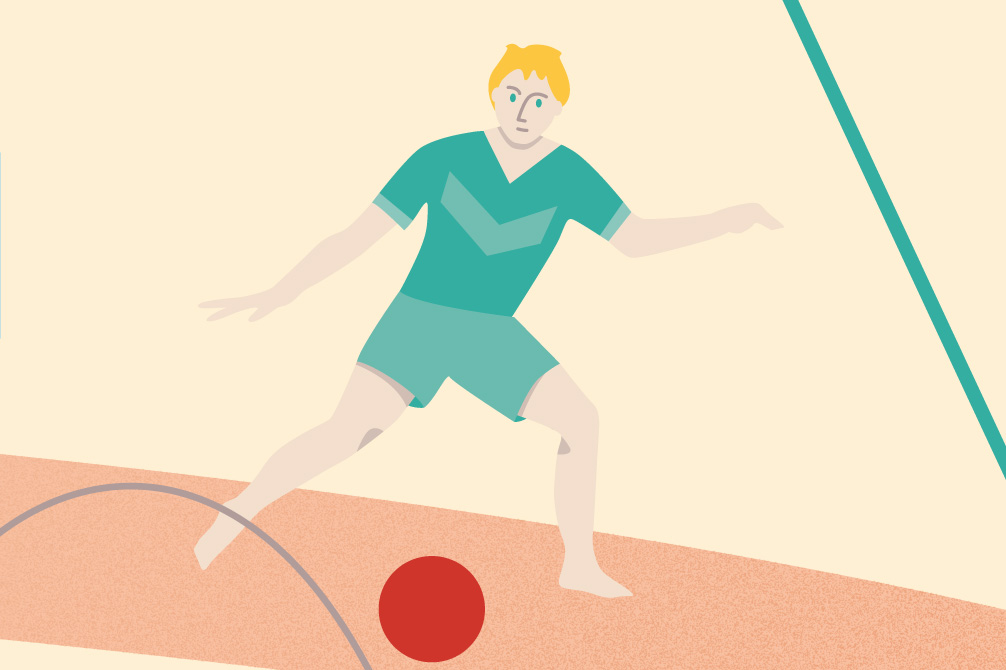Rechte Klagen

Wie Rechtsextreme die „Lügenpresse“ durch Klagen mundtot machen wollen.
Die Ablehnung von gesellschaftskritischem Engagement Andersdenkender verdeutlicht sich in vielen rechtsextremen Kreisen nicht zuletzt in ihrem Umgang mit (linken und alternativen) Medien. Durch Vorwürfe wie jenem der „Lügenpresse“ wird dabei versucht, sich gegen Kritik zu immunisieren und politische Gegner_innen durch finanziell aufwändige Klagen einzuschüchtern.
„SYSTEMHANDLANGER“. Journalist_innen scheinen es aktuell angesichts des sinkenden gesellschaftlichen Vertrauens in Medien und der steigenden Angriffe nicht leicht zu haben. So zeigte 2016 eine repräsentative Umfrage für den Bayerischen Rundfunk, dass die Mehrzahl der in Deutschland lebenden Menschen die Medien für gelenkt hält. Bedient und verstärkt wurde das Ressentiment der „gleichgeschalteten“, „Meinungsbildung betreibenden“ Berichterstattung unter anderem auf den von antimuslimischem Rassismus geprägten Pegida- Demonstrationen. Im Skandieren von Begriffen wie „Lügen-“ oder auch „Systempresse“ bei derartigen Events verdeutlicht sich, dass von weit rechts Außen bis zur gesellschaftlichen Mitte Medien pauschal als „Handlanger des Systems“ und manipulierende Propaganda imaginiert werden, gegen die sich die vermeintliche Rebellion des Volks zur Wehr setzen müsse. So wird zwar nach Meinungsfreiheit oder -vielfalt gerufen, ohne diese jedoch selbst zu vertreten, da die eigene Perspektive als die einzig wahre inszeniert und der Rest als Lügen verunglimpft wird. Dieser Vorwurf trifft somit vor allem jene, die versuchen, differenziert, kritisch und sachlich zu berichten. Obgleich der Begriff „Lügenpresse“ sogar zum Unwort des Jahres 2014 gewählt wurde, blieb eine weiter reichende Diskussion über die verantwortungsvolle Aufgabe der Medien aus. Dennoch liefern diese Entwicklungen ein anschauliches Beispiel für die tiefe Verankerung rechtsextremer Logiken in der gesellschaftlichen Mitte.
BILDRECHTE UND GEGENKLAGEN. Während manche Journalist_innen in vorauseilendem Gehorsam und gemäß des gesellschaftlichen Klimas ohnehin bereits nach rechts geschwenkt sind, versuchen insbesondere linke Medien nach wie vor ungeschönt über rechtsextreme Entwicklungen und Aktivitäten in Österreich aufzuklären. Immer öfter sind sie in dieser Arbeit mit Klagen von rechten/ rechtsextremen Einzelpersonen, Gruppen und Parteien konfrontiert. Egal, ob gegen den Tiroler SPÖ-Chef, der Norbert Hofer (FPÖ) als „Nazi“ bezeichnet hatte, die Betreiberin des Cafés „Fett und Zucker“, die mittels eines Schildes Hofer-Wähler_ innen aufgefordert hatte, ihren Betrieb nicht zu besuchen. Aber auch die Anfechtung der Bundespräsidentschaftswahl zeigt, wie gerne die FPÖ klagt. Aus diesem Grund versuchte die Initiative „Heimat ohne Hass“, die mittels eines Internetblogs rechtsextreme Vorfälle in Österreich dokumentiert, vorletztes Jahr bei einer Pressekonferenz gemeinsam mit anderen darauf aufmerksam zu machen, dass die FPÖ seit geraumer Zeit versuche, antifaschistische Projekte auf diese Weise mundtot zu machen.
„Heimat ohne Hass“ muss sich nämlich mit einer Urheber_innenrechtsklage wegen der Veröffentlichung eines Fotos auseinandersetzen. Im Zuge der polizeilichen Räumung des linken Projekts „Pizzeria Anarchia“ in Wien, hatte der Blog über einen freiheitlichen Personalvertreter berichtet, der vor Ort bewaffnet und mit einem eisernen Kreuz aufgetreten war. Geklagt hatte in diesem Fall die freiheitliche Gewerkschaft AUF. Eine Gegenklage der FPÖ beschäftigte auch das linke Kollektiv „Filmpirat_innen“. Nachdem die FPÖ widerrechtlich Materialien des Filmkollektivs verwendet hatte, schlug die Partei mit einer Gegenklage wegen „falscher Behauptungen“, die „die Meinungsfreiheit der FPÖ behindern“ würden, zurück. Auch gegen das Urteil, das den „Filmpirat_innen“ Recht gab, legte die Partei Berufung ein. Bedrohlich wirken auch Fälle staatlicher Angriffe auf Jounalist_innen und Medien. So wurden beispielsweise 2007 in Berlin mehrere Fotografen vom Landeskriminalamt (LKA) wegen „Fotografieren von Neonazis bei Naziaufmärschen“ überwacht. Ermittelt wurde vom Berliner LKA (Abteilung Linksextremismus) auch gegen das Antifaschistische Pressearchiv und Bildungszentrum (apabiz), weil sie in einem Dossier über einen Neonaziaufmarsch einen Teil eines indizierten Aufruftexts zur Demo zitiert hatten.
EINSCHÜCHTERUNGSSTRATEGIEN. Wie die beiden Beispiele aus Österreich verdeutlichen, geht es oftmals nicht um politische Inhalte, die vor Gericht zur Diskussion gestellt werden sollen. Rechte bedienen sich dem Mittel der Klage vor allem, um öffentliche Kritik durch mit Rechtsstreiten verbundene Einschüchterungen oder große finanzielle Belastungen zu delegitimieren und zum Schweigen zu bringen. Nicht selten sind die Klagswerte im fünfstelligen Bereich angesiedelt, was bedeutet, dass zumeist das nötige Kleingeld fehlt, um dagegen vorzugehen. Die Anzahl derartiger Klagen und Klagsdrohungen ist zudem weitaus höher als öffentlich bekannt. Dass selbst von betroffenen Medien selten darüber berichtet wird, liegt nicht zuletzt daran, dass Rechtsextreme damit in erster Linie versuchen, linke/kritische Strukturen einzuschüchtern und die Klagsdrohungen selbst meist wenig Gehalt haben. Vielmehr ist es Teil der Einschüchterungsstrategie, unabhängig vom erwarteten Erfolg zeitraubend und belastend viele Ressourcen der Betroffenen zu binden.
Judith Goetz ist Literatur- und Politikwissenschafterin und Mitglied der Forschungsgruppe Ideologien und Politiken der Ungleichheit (fipu.at).